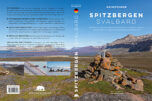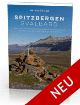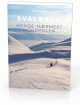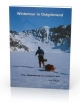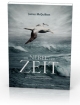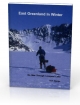-
aktuelle
Empfehlungen- Spitzbergen unter Segeln 2025
Kurs Arktis im Sommer 2025
- Spitzbergen-Reiseführer
Aktualisierte Neuauflage 2025
- Spitzbergen unter Segeln 2025
Kurs Arktis im Sommer 2025
Seitenstruktur
-
Nachrichten
- Monat auswählen
- Mai 2025
- April 2025
- März 2025
- Februar 2025
- Januar 2025
- Dezember 2024
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- April 2024
- März 2024
- Februar 2024
- Januar 2024
- Dezember 2023
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- August 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- Februar 2022
- Januar 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- Oktober 2021
- September 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- April 2021
- März 2021
- Februar 2021
- Januar 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- September 2020
- August 2020
- Juli 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- April 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Januar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- Oktober 2019
- September 2019
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- Januar 2019
- Dezember 2018
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- August 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Januar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Juli 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012
- März 2012
- Februar 2012
- Januar 2012
- Dezember 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- August 2011
- Mai 2011
- April 2011
- März 2011
- Februar 2011
- Januar 2011
- Dezember 2010
- November 2010
- September 2010
- August 2010
- Juli 2010
- Juni 2010
- Mai 2010
- April 2010
- März 2010
- Februar 2010
- November 2009
- Oktober 2009
- September 2009
- August 2009
- Juli 2009
- Juni 2009
- Mai 2009
- April 2009
- März 2009
- Februar 2009
- Januar 2009
- Dezember 2008
- November 2008
- Oktober 2008
- August 2008
- Juli 2008
- Juni 2008
- Mai 2008
- April 2008
- März 2008
- Februar 2008
- April 2000
- Monat auswählen
-
Wetterinformationen
-
Newsletter

| Spitzbergen-Reiseführer: Neuauflage ist da 🤩 |
Home →
Jahres-Archiv: 2022 − Nachrichten
Die Touristen waren es. Oder doch die Russen?
Achtung, dieser Beitrag enthält ein polemisches und gerade derzeit möglicherweise geschmackloses Wortspiel, und das vor einem in mehrfacher Hinsicht durchaus ernsten Hintergrund.
Es fing ganz unkompliziert an: Alle, die schon einmal in Longyearbyen waren, kennen die berühmten Eisbärenwarnschilder, die an den Ortsausgängen stehen, am Hafen, im Adventdalen und im oberen Longyeardalen.

Eisbärenwarnschild im Adventdalen bei Longyearbyen.
Nun verschwand das Schild im Adventdalen eines Nachts Mitte Mai – zu Zeiten der Mitternachtssonne ein durchaus gewagter Diebstahl einer so berühmten, symbolträchtigen Attraktion an einer Straße, die zwar scheinbar ins Nirgendwo führt, wo es aber dennoch zu nahezu allen möglichen und unmöglichen Uhrzeiten bemerkenswert viel Verkehr gibt.
Natürlich gingen die Spekulationen hoch, wer es gewesen sein könnte. Wer in Longyearbyen wäre schon so dumm, sich dieses Schild, das wirklich jede und jeder dort kennt, an die Wand zu hängen?
Aber klar, die locals sind natürlich immer die Guten, die Bösen sind woanders zu finden. Und nun wird es peinlich: die Svalbardposten berichtete über das Schilder-Drama. Ein Busfahrer meldete sich als Kronzeuge, der Mann hatte zwar nichts Tatrelevantes gesehen, fährt aber jeden Tag Touristen und muss es daher natürlich ganz genau wissen: „Det er jo turistene som stjeler sånt, sier han.“ „Es sind ja die Touristen, die solche Sachen klauen, sagt er.“ (Zitat Svalbardposten). Nicht nur, dass der Satz so ohne weiteres Hinterfragen durch den Journalisten übernommen wurde – in der Druckausgabe wurde er sogar zur Überschrift, nicht einmal als Zitat gekennzeichnet. Jaja, diese bösen Touristen!

Artikel in der Druckausgabe der Svalbardposten vom 19. Mai:
Überschrift „Es sind ja die Touristen, die solche Sachen klauen“.
In der oben verlinkten Online-Ausgabe des Svalbardposten-Artikels lautet die Überschrift mittlerweile immerhin anders: „Hvem har stjålet isbjørnskiltet?“ („Wer hat das Eisbärenschild geklaut?“).
Die Sache bekam ein paar Tage später immerhin eine erfreulich humoristische Wendung: Das Schild tauchte plötzlich wieder auf – und zwar im am Flughafen geparkten Auto von Lars Fause. Das ist der Sysselmester höchstpersönlich.
Dieser war allerdings zur fraglichen Zeit nachweislich auf dem Festland und daher persönlich unverdächtig, und dass er das Schild für alle gut sichtbar in sein öffentlich geparktes Auto gelegt hätte, erscheint auch eher unwahrscheinlich.
Des Rätsels Lösung (Vorsicht, jetzt kommt das Wortspiel): die Russen waren es. Aber nicht die Russen, die in Barentsburg Kohle abbauen, wobei es ohnehin überwiegend Ukrainer sind, die dort in der Grube arbeiten. Und schon gar nicht die Russen, die in der Ukraine derzeit die Welt in Brand stecken. „Russ“ auf Norwegisch ist der Abiturient, in der bestimmten Form – mit angehängtem bestimmten Artikel – „Russen“. Das heißt tatsächlich gleichzeitig auch „der Russe“, aber der ist hier gerade mal nicht gemeint. In der „russetid“, der Abiturientenzeit, feiern die Schulabgänger wild und ausgelassen, und dabei gibt es natürlich auch Streiche. Das geklaute Eisbärenwarnschild war ein solcher und nichts anderes, und zwar ein durchaus gelungenger Streich, wie auch Sysselmester Lars Fause findet. Immerhin.
Traurig ist es, dass der ressentimentbehaftete Reflex, erst mal Touristen als Urheber allen Übels zu vermuten, unhinterfragt nicht nur am Stammtisch, sondern auch gegenüber einer Zeitung geäußert wird und diese nicht auf die Idee kommt, das zu hinterfragen, sondern den Satz sogar noch zur Überschrift ihres Artikels macht. Man könnte müde darüber lächeln, wenn diese Haltung nicht auch ganz andere, bedeutungsschwere Diskussionen prägen würde, die derzeit laufen, etwa die drohende Schließung großer Teile der Inselgruppe Spitzbergen für die Öffentlichkeit (hier läuft die Diskussion derzeit in den zuständigen Behörden, eine Entscheidung steht noch aus bzw. ist noch nicht öffentlich bekannt).
Vielleicht sollte man lieber noch einen Moment nachdenken, bevor man Touristen (oder wen auch immer) für eine Untat verantwortlich macht, ohne zu wissen, wer es denn tatsächlich war.
Ein neues Niveau der Hysterie. Kommentar von Morten Jørgensen
Gastbeitrag mit einem Kommentar von Morten Jørgensen zur aktuellen Diskussion, ob Touristen Eisbären „rund um die Uhr“ stören (siehe dieser Beitrag von Rolf Stange, hier klicken). Mortens Beitrag ist nur auf englisch verfügbar. Um ihn zu lesen, wechseln Sie bitte auf die englische Version dieser Seite (Flaggensymbol oben auf der Seite oder einfach hier klicken).
Rettungshubschrauber sollen Mobiltelefone orten können
Hinweis: potenziell sicherheitsrelevanter Praxistipp am Ende des Beitrags!
Der Betrieb der Rettungshubschrauber auf Spitzbergen wird nach gesetzlicher Vorschrift alle paar Jahre neu ausgeschrieben. Nach Airlift und Lufttransport ist nun CHC Helikopter Service der Betreiber, eine norwegische Tochter der kanadischen Firma CHC Helicopter.
Das vor Ort befindliche Personal bleibt über den Betreiberwechsel unverändert, um den durchgehenden Betrieb auf Basis langjähriger Erfahrung zu gewährleisten. Selbst im unmittelbaren Zeitraum der Übergabe gab es Rettungseinsätze, die daher reibungslos abgewickelt werden konnten.

Hubschrauber des Sysselmannen (heute: Sysselmester) vom Typ Super Puma:
wird nun modernisiert. (Archivbild von 2015).
Auch die Hubschrauber selbst bleiben dieselben, aber laut Svalbardposten hat CHC Helikopter Service hat angekündigt, die Maschinen technisch zu modernisieren. So sollen sie unter anderem neue Infrarotkameras („Wärmebildkameras“) bekommen sowie Geräte, die es ermöglichen, Mobiltelefone zu orten – und zwar unabhängig davon, ob es im Suchgebiet Mobilnetz gibt, was in großen Teilen Spitzbergens nicht vorhanden ist.
Vorraussetzung ist allerdings – und das ist der oben angekündigte sicherheitsrelevante Praxistipp – dass das Mobiltelefon eingeschaltet und nicht im Flugmodus ist. Dann sendet das Telefon ein Signal, das auch ohne Mobilfunknetz von den am Hubschrauber befindlichen Sensoren empfangen und geortet werden soll.
Eine weitere Voraussetzung scheint zu sein, dass den Rettungskräften die Mobilnummer bekannt ist. Erfahrungsgemäß ist es aber oft so, dass diese Information oft vorhanden ist, wenn Vermisstenanzeigen aufgegeben werden. Wer Freunde, Verwandte oder Bekannte vermisst, hat meist deren Handynummer.
Fazit: Wer sich in Spitzbergen auf Tour begibt, sollte entgegen der bislang weit verbreiteten Praxis das Mobiltelefon für den Fall der Fälle auch dann angeschaltet lassen und nicht in den Flugmodus setzen, wenn es kein Mobilnetz gibt. Und natürlich sollte jemand in der Zivilisation die Tourenpläne kennen und wissen, zu welchem Zeitpunkt ggf. Alarm zu schlagen ist. Dass diese Person die Mobilnummer des Tourengehers haben sollte, ist ohnehin selbstverständlich.
Störungen von Eisbären durch Touristen?
Die erste „normale“ – soweit ohne Beeinträchtigung durch Corona – Sommersaison seit 2019 in Spitzbergen hat begonnen. Zwar hat der Winter gerade erst begonnen, seinen frostigen Griff um die Inseln zu lösen, große Teile des Landes sind noch von Schnee bedeckt, viele Fjorde zumindest teilweise gefroren und im Norden und Osten gibt es noch eine Menge Treibeis in Svalbards Gewässern.
Aber schon seit Wochen fahren Schiffe mit Touristen auch wieder zu mehrtägigen Fahrten in Spitzbergens Küstenfahrwasser; schiffsbasierte Tagestouren laufen bereits seit März. Es ist noch gar nicht lange her, dass ein so früher Beginn der „sommerlichen“ Schiffssaison undenkbar war: Wintersaison bis etwa Mitte Mai, dann ein paar Wochen Pause mit wenig Aktivität, im Juni Beginn der Sommersaison, in der Schiffe eine Rolle spielen. So war es früher, und da muss man nicht mehr als etwa 20 Jahren zurückgehen. Seitdem wurde der Beginn der „Sommer“saison mehr und mehr nach vorn verlegt.
Nun fahren also bereits wieder mehrere Dutzend Touristenschiffe, und schon jetzt gibt es Ärger: Es zirkulieren Bilder, die Nahbegegnungen von Touristen auf Schiffen und Eisbären zeigen, und prompt schlagen die Wellen in den Medien hoch. So berichtete auch Norwegens wohl wichtigste Nachrichtenseite NRK; schon in der Überschrift heißt es, dass „die Eisbären auf Svalbard rund um die Uhr von Touristen gestört werden“.

Eisbär bei einem Schiff an der Eiskante: wer besucht hier wen? Und wer wurde verfolgt, wer wird hier gestört oder gar gefährdet? Vielleicht ja auch: keiner. (Archivbild von 2015).
Es geht um Bilder wie dieses, die Eisbären und Schiffe mit Menschen in enger Nähe zueinander zeigen. Situationen dieser Art hat es in den letzten Wochen in Spitzbergen mehrfach gegeben und nun zirkulieren die Bilder und die Meinungen gehen hoch. Auch auf offizieller Seite ist man nicht begeistert, der Sysselmester hat eine Untersuchung in Gang gesetzt.
Man ist sich einig: Brüche geltender Gesetze oder Ethik, geschrieben oder ungeschrieben, sind nicht hinnehmbar und sollten gegebenenfalls verfolgt und mit Strafe belegt werden.
Gesetzbruch, ethischer Verstoß oder völlig in Ordnung?
Die Frage ist nur: Ist es wirklich so einfach? Anscheinend ja: Journalisten (NRK) gehen mit Selbstverständlichkeit davon aus, dass die Eisbären von Touristen gestört werden, und zwar „rund um die Uhr“. Aber was zeigt ein Bild wie das obige? Das Bild, das aktuell einen wesentlichen Anstoß zur Aufregung gab, wurde vom Fotografen übrigens mittlerweile von den öffentlichen Plattformen gelöscht, aber es zeigt – von der Außenperspektive eines unbeteiligten Schiffes – eine sehr ähnliche Situation wie das hier gezeigte Bild. Ist die dargestellte Situation also problematisch oder nicht?
Ich war selbst über die Jahre etliche Male in Situationen dieser Art: Ein Schiff ist unbeweglich an der Eiskante oder im Treibeis geparkt. Ein Eisbär bekommt – im wahrsten Sinne – Wind davon. Eisbären sind von Natur aus häufig neugierig, die Neugier des Tieres wird auch in der fraglichen Situation geweckt. Der Eisbär kommt näher, manchmal sogar bis auf Nasenfühlung zum Schiff, schnüffelt am Rumpf, beäugt es mit einer Mischung aus Neugier und Misstrauen, während die Menschen an Bord Fotos machen. Schließlich ist die Neugier des Eisbären befriedigt und er (oder sie, auch Eisbärinnen können sehr neugierig sein) zieht seiner Wege.
Natürlich weiß man als unbeteiligter Betrachter, der vielleicht nur das Bild gesehen hat – und das trifft auf fast alle zu, die sich aktuell äußern – wenig über den tatsächlichen Verlauf des einzelnen Falles. Natürlich ist inakzeptables oder gar strafrechtlich relevantes Verhalten denkbar: Wurde der Eisbär etwa angelockt oder sogar gefüttert? Beides ist verboten und nicht akzeptabel. Solange es aber keine Informationen gibt, dass so etwas vorgekommen ist, gibt es auch keinen Grund dazu, das anzunehmen: Die bloße Anwesenheit eines Schiffes reicht aus, um bei einem Eisbär Neugier hervorzurufen, die dazu führen kann, dass er zum Schiff kommt. Das ist gar nicht ungewöhnlich und auch nicht verwerlich. Weder ist es aus meiner Sicht unethisch, da es keine Störung oder Gefährdung bedeutet (Menschen an Bord eines Schiffes sind prinzipiell sicher, es sei denn, es ist so klein, dass der Eisbär mit einem Sprung an Bord kommen kann. Das ist aber weder beim hier gezeigten Bild so noch war es so im aktuell fraglichen Fall. Ein Sprung an Bord eines Schiffes, wo Menschen an Deck sind, wäre auch ein völlig unnatürliches Verhalten; von einem Fall dieser Art habe ich noch nie gehört). Auch rechtlich ist das nach heutigem Stand nicht zu beanstanden: Im Spitzbergen-Umweltgesetz (Svalbard miljølov) heißt es in § 30: „Es ist verboten, Eisbären anzulocken, zu füttern, zu verfolgen oder mit einer anderen aktiven Handlung so aufzusuchen, dass der Eisbär gestört wird oder Gefahr für Menschen oder Eisbären entstehen kann“ (eigene Übersetzung). Und von diesen zu Recht verbotenen Handlungen kann wohl auch nicht die Rede sein, wenn ein Eisbär von sich aus ein am oder im Eis geparktes, bewegungsloses Schiff aufsucht.
Alles gut also?
Wie gesagt, natürlich sind absolut inakzeptable Szenarien denkbar, die zu Recht eine behördliche Reaktion erfordern würden. Das erscheint im fraglichen Fall aber sehr unwahrscheinlich. Im konkreten Fall, der aktuell Anstoß zur Aufregung gegeben hat, war das fragliche Schiff im Eis geparkt. Zufällig war ich übrigens in der Nähe – zu weit weg, um Details erkennen zu können, aber es war erkennbar, dass das kleine Segelboot sich über längere Zeit nicht bewegte.
Der Versuch, einen Bären im Treibeis mit einem Schiff zu folgen, wäre übrigens kaum ein realistisches Szenario für größere Störungen: Selbst im entspannten Tempo ist ein Eisbär im Treibeis deutlich schneller als die meisten Schiffe, abgesehen von Eisbrechern.
Anders sieht es aus, wenn eine Annäherung mit Motorschlitten auf gefrorenen Fjorden erfolgt, was schon lange streng verboten ist; das Fahren auf Fjordeis ist schon seit Jahren stark eingeschränkt. Auch mit kleinen, schnellen Booten im offenen Wasser sind Störungen von Eisbären, die sich auf einzelnen Eisschollen oder am Ufer befinden, denkbar. Hier muss man wohl davon ausgehen, dass nicht alle über die nötige Sensibilität verfügen, um beim ersten Anzeichen einer Störung direkt zu stoppen und ggf. abzudrehen. Eine weitere Annäherung, die zu einer Störung führt, ist schon lange verboten.
Eine solche Situation lag aber aktuell nicht vor. Woher NRK-Journalist Rune N. Andreassen wissen will, dass Touristen Eisbären „rund um die Uhr stören“, wie schon die Überschrift zu seinem oben verlinkten Artikel behauptet, verrät er nicht. Die Vermutung liegt nahe, dass hier öffentliche Empörung bedient wurde, der die sachliche Grundlage fehlt. Es leuchtet ein, dass die fraglichen Bilder fragwürdig erscheinen können, wenn der Betrachter nicht über entsprechende Erfahrung aus eigenem Erleben verfügt. Vor einem öffentlichen Urteil, das absehbar große Aufmerksamkeit erfährt, würde es aber nicht schaden, sich dem Einzelfall im konkreten Detail des Verlaufs zu widmen.
Zumal wenn die Debatte in politisch bereits aufgeheizte Zeiten fällt: Im Gespräch ist ein verpflichtender Mindestabstand von 500 (fünfhundert) Metern.
Anstatt einen Eisbären seine Neugier ausleben zu lassen, solange sie nicht zu Gefährdung führt, müsste man also mit dem Schiff wegfahren – im Bedarf auch kurzfristig und schnell – oder aber den Bären mit Lärm verscheuchen, etwa mit Schüssen aus der Signalpistole. Ob dadurch im Interesse des Eisbärenschutzes irgend etwas zu gewinnen ist, wage ich zu bezweifeln.
Als Illustration seines Artikels verwendet Andreassen übrigens ein Bild, das laut Bildkommentar „aus gehörigem Abstand“ aufgenommen wurde. Meiner Einschätzung nach wurde es aus vielleicht 50 Metern Entfernung aufgenommen. Ein Zehntel des Mindestabstandes, der derzeit vom norwegischen Gesetzgeber erwogen wird. Wenn alle sich darauf einigen könnten, dass 50 Meter ein „gehöriger Abstand“ für das Betrachten von Eisbären sind und dass die geforderten 500 Meter doch „etwas“ übertrieben sind, wäre schon eine Menge Schärfe aus der Debatte genommen.
Feier zum 17. Mai ohne Kinder aus Barentsburg
Der 17. Mai ist der norwegische Nationalfeiertag und wird überall im Land mit viel Begeisterung und großer öffentlicher Anteilnahme gefeiert, auch in Longyearbyen.
Dort gehörte es zur lange gepflegten, guten Praxis, dass die Nachbarn aus Barentsburg an den Feierlichkeiten teilnahmen. Es kamen sowohl offizielle Vertreter der Grubengesellschaft Trust Arktikugol und des Konsulats, die an zentralen Stellen der Feierlichkeiten Redebeiträge beisteuerten, als auch Kinder, die in Longyearbyen mit den dort ansässigen Kindern zusammen kamen.

Repräsentanten aus Barentsburg hielten neben Sysselmannen (heute: Sysselmester) und dem Bürgermeister von Longyearbyen Reden zum 17. Mai (Archivbild von 2019).
Die offiziellen Vertreter waren dieses Jahr nicht eingeladen worden, die Kinder und deren „notwendige Begleitung“ aber schon. Deren Teilnahme war aber laut Svalbardposten von Barentsburg „nach interner Diskussion“ abgesagt worden. Damit kam es im Rahmen der Feierlichkeiten zu diesem 17. Mai nicht zu einer Begegnung zwischen den Nachbarn Longyearbyen Barentsburg. Eigentlich war geplant, dass die Kinder aus Longyearbyen und Barentsburg zusammen singen.
Die Verwaltung in Longyearbyen hofft, dass die Entwicklung bald wieder eine Normalisierung der nachbarschaftlichen Beziehungen zulassen.
Margas Arktis-Fernsehtipps für den Mai
Hier kommen Margas arktische Fernsehtipps für den Mai 2022. Unterdessen ist im Norden schon wieder „Arktis unter Segeln“, derzeit mit der Meander. Wir sind am 25.4. in Alta losgefahren und werden Kurs auf die Bäreninsel und Spitzbergen setzen, nachdem wir zunächst wetterbedingt noch etwas Zeit in geschützten Gewässern an der Küste Norwegens verbracht haben.
Aber dazu dann im Blog mehr.

Arktis Fernsehtipps: Der Fernseher in der Ritterhütte auf Gråhuken.
Der Empfang ist dort mitunter allerdings eher schlecht.
Die Listen werden bei Bedarf aktualisiert. Sachdienliche Hinweise werden von jeder Spitzbergen.de-Dienststelle entgegengenommen.
Margas Arktis-Fernsehtipps auf Arte im Mai
- Donnerstag, 05.05., 18.30 Uhr: „Eden auf Erden – Die letzten Paradiese: Patagonien – Am Ende der Welt“ (GB 2021, EA)
- Freitag, 06.05., 17.50 Uhr: „Die schönsten Landschaften der Welt: Die kanadischen Rocky Mountains“ (GB 2021, EA)
- Freitag, 06.05., 18.30 Uhr: „Eden auf Erden – Die letzten Paradiese: Alaska – Amerikas arktische Grenze“ (GB 2021, EA)
- Dienstag, 10.05., 22.45 Uhr: „Chinas Arktis-Feldzug“ (F 2021)
- Mittwoch, 11.05., 17.05 Uhr: Wdhlg.: Alaska …
- Samstag, 14.05., 16.40 Uhr: Wdhlg.: Alaska ….
- Montag, 23.05., 19.40 Uhr: „Re: Kabeljauzungen-Schneider: Traditionsjob für die Kinder der Lofoten“ (D 2022, EA)
- Dienstag, 24.05, 12.10 Uhr: „Wdhlg. Re: Kabeljauzungen …
EA = Erstausstrahlung.
Margas Arktis-Fernsehtipps auf anderen Programmen …
- Sonntag, 08.05, 21.00 Uhr, RBB: „Die kleinen Giganten des Nordens: Das Geheimnis der Lemminge“ (D 2017)
- Donnerstag, 12.05, 21.00 Uhr, NDR: „Mit dem Schiff durch Patagonien“ (D 2017)
Alle Angaben wie immer ohne Gewehr.
Neues Buch: Norwegens arktischer Norden (3): Die Bäreninsel und Jan Mayen
„Norwegens arktischer Norden“ entwickelt sich nun langsam zu einer wunderschönen Arktis-Fotobuchreihe: Nun ist der dritte Teil abgeschlossen und im Druck, Bestellungen sind ab sofort möglich! Die Auslieferung erfolgt ab Mitte Mai 🙂
In „Norwegens arktischer Norden (3): Die Bäreninsel und Jan Mayen“ geht es – Überraschung! – um die Bäreninsel und Jan Mayen. Diese beiden wilden, schönen, abgelegenen, spannenden Inseln bekommen hier endlich den Bildband, den sie verdienen. Wie schon der erste Teil der Reihe „Norwegens arktischer Norden“ wird auch dieser dritte Teil ein wertiges Hardcover im A4-Querformat mit über 200 prallgefüllten Seiten sein.

Neues Buch: Norwegens arktischer Norden (3): Die Bäreninsel und Jan Mayen.
Ab sofort bestellbar!
Das Buch ist ebenso informativ wie unterhaltsam, im Text geht es immer wieder in lockerem Ton um die naturkundlichen und historischen Hintergründe. Den roten Faden bilden aber meine Erlebnisse und kleinen Abenteuer auf beiden Inseln, von den wildschönen Küsten bis auf die höchsten Erhebungen, darunter der Gipfel des Beerenberg! Hier geht es nicht „nur“ um kurze Besuche während schneller Passagen mit Kreuzfahrtschiffen. Ich habe mir beide Inseln erwandert, soweit die Füße tragen, und diese Grenze habe ich wirklich gedehnt … das Ergebnis sind eindrückliche Bilder faszinierender Landschaften, darunter viele, die kein Tourist jemals auf „normalen“ Reisen zu sehen bekommt.
All das natürlich reichlich in Farbe bebildert mit vielen Fotos, und kleinen Karten bieten jederzeit die Orientierung.
Bildergalerie: Bildbeispiele aus „Norwegens arktischer Norden (3): Die Bäreninsel und Jan Mayen“
Einige Beispielfotos aus dem Buch – nur eine kleine Auswahl aus mehreren hundert Bildern!
Fotogalerie „Bäreninsel“
- Galerie-Anker-Link: #galerie_2201
Klicken Sie auf die Bilder, um eine vergrößerte Darstellung des Bildes zu erhalten.
Fotogalerie „Jan Mayen“
- Galerie-Anker-Link: #galerie_2202
Klicken Sie auf die Bilder, um eine vergrößerte Darstellung des Bildes zu erhalten.
(Die Seitenverhältnisse habe ich hier für die Wiedergabe als Galerie angepasst; im Buch sind sie teilweise anders.)
Leseproben
Ein paar Blicke ins Buch! Natürlich sind das nur einzelne Seiten – für einen Eindruck vom Inhalt.
- Seite 6-7 (Übersichtskarte und Anfang der Einführung)
- Seite 36-37 (unterwegs auf der Bäreninsel)
- Seite 122-132 (erste Eindrücke auf Jan Mayen)
- Seite 168-169 (auf dem Beerenberg)
Hier klicken für weitere Informationen und Bestellmöglichkeit.
Tödliches Motorschlittenunglück auf dem Longyearbreen
Am Sonntag (10.4.) Nachmittag hat sich auf dem Longyearbreen, einem Gletscher wenige Kilometer südlich von Longyearbyen, während einer Motorschlittentour ein Unglück ereignet. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Später wurde ihr Tod von offizieller Seite bestätigt.
Darüber hinaus ist bislang offiziell nur bekannt, dass es sich bei dem Unfallopfer um eine nicht ortsansässige Frau handelte, die mit einer privaten Gruppe auf Tour war. Weitere Details zum Hergang und zur Unfallursache sind bislang noch nicht öffentlich.

Der untere Longyearbreen. In diesem Bereich ereignete sich am Sonntag Nachmittag ein tödlicher Unfall während einer Motorschlittenfahrt (Foto von Ende März 2022).
Anmerkung: Ursprünglich stand in diesem Beitrag, dass die Frau mit einer geführten Gruppe unterwegs war. Das war nicht korrekt. Sie war mit einer privaten Gruppe unterwegs, die aus Einheimischen und Zugereisten bestand.
Ergänzung: Am Montag Mittag veröffentlichten die Behörden nach Absprache mit den Angehörigen den Namen des Unfallopfers. Es handelte sich um eine Norwegerin aus Trondheim.
Sanktionen treffen auch Barentsburg
Die internationalen Sanktionen, die viele Staaten als Reaktion auf den russischen Angriffs- und Vernichtungskrieg gegen die Ukraine eingeführt haben, treffen auch den russischen Norden, darunter Barentsburg.
Russlands wichtigster Hafen für den Kohleexport ist Murmansk. Von dort wurden laut Barents Observer nach kräftigem Wachstum im Jahr 2019 mehr als 16 Millionen Tonnen Kohle verschifft. Abnehmer waren bislang die EU – hier vor allem Deutschland – und Großbritannien sowie Israel. Der Export entwickelte sich so stark, dass ein neuer Kohlehafen in Lavna auf der Kola-Halbinsel in Planung ist. Dieses Projekt steht nun wohl auf der Kippe.
Im Vergleich zu den Exporten ab Murmansk sind die in Barentsburg produzierten und verschifften Mengen mit etwa 100.000 Tonnen im Jahr zwar bescheiden und für den globalen Markt irrelevant, für die russische Siedlung in Spitzbergen sind sie aber noch wie vor von großer Bedeutung. In jüngeren Jahren hat man dort zwar den Tourismus entwickelt, wo zeitweise bis zu 80 Menschen arbeiteten, aber dieser ist zunächst wegen Corona und nun wegen der Sanktionen sowie freiwilliger Zurückhaltung der Branche bereits stark eingebrochen. Damit gewinnt der Bergbau zumindest relativ wieder mehr Bedeutung für Arbeitsplätze und Wirtschaft in Barentsburg. Von rund 300 Einwohnern arbeiten etwa 150 unter Tage. Darunter sind viele Ukrainer.
Laut Highnorthnews, wo man sich auf den Sysselmester beruft, gibt es in Barentsburg 120 Russen, aber sogar 220 Ukrainer.

Industrieanlagen und Kohlehalde in Barentsburg: die internationalen Sanktionen werden sich auch hier bemerkbar machen.
Hauptabnehmer der Barentsburg-Kohle war bislang Großbritannien. Auch dort werden allerdings Importverbote für russische Kohle eingeführt, wie auch in der EU. Damit dürfte eine wichtige Existenzgrundlage für den Bergbau in Barentsburg zusammenbrechen.
Irritierendes Interview des russischen Konsuls in Barentsburg
Letzte Woche – noch vor dem öffentlichen Bekanntwerden der grausamen Bilder aus Butscha – hatte der russische Konsul in Barentsburg für Irritationen gesorgt, als er gegenüber norwegischen Medien (nettavisen.no) die Bilder der Zerstörungen in Mariupol als Fälschungen und die Berichterstattung in westlichen Medien als „fake news“ bezeichnet hatte, wohingegen seiner Aussage zufolge die russische Berichterstattung verlässlich sei. Der verlinkte Beitrag ist auf norwegisch, aber das Interview mit dem Konsul wurde auf englisch geführt. Es ist unten im Beitrag von nettavisen.no zu sehen. Die Bewohner von Barentsburg scheinen politische Diskussionen zu vermeiden, sowohl untereinander als auch gegenüber Medien, wie NRK vor Ort feststellte.
Spendenaktion: Ein Herz für die Ukraine
Als Spendenaktion für ukrainische Kriegsopfer gibt es im Spitzbergen.de-Webshop Anstecker in Herzform in den Farben der Ukraine. Die Anstecker werden in Handarbeit in Longyearbyen hergestellt, der Erlös dient vollständig als Spende. Hier klicken für mehr Info zu den Ansteckern „Ein Herz für die Ukraine“.
Ein Herz für die Ukraine: Anstecker aus Longyearbyen – Spendenaktion
Neu im Spitzbergen.de-Onlineshop: Ein Herz für die Ukraine! Schön und handgemacht in Longyearbyen als Spendensammelaktion für die Ukraine.
Diese Herz-Buttons (Anstecker) in den Farben der Ukraine werden in Longyearbyen von Julia Lytvynova aus Kharkiv in der Ukraine hergestellt. Der Verkauf dient vollständig als Spende für die Ukraine!

Ein Herz für die Ukraine – handgemacht in Longyearbyen zum Spendensammeln.
Manche meinen, in Spitzbergen seit man vom Übel der Welt weit weg. Weit gefehlt! Es sind keine 40 Kilometer bis Barentsburg, einem Ort, wo nach wie vor mehrere hundert Russen und Ukrainer zusammen leben.
Vor allem aber leben auch in Longyearbyen Menschen aus der Ukraine. Die Begegnungen mit ihnen gehen in dieser Zeit unter die Haut.

Ein kleine Sammlung von Herzen für die Ukraine.
Julia Lytvynova stammt aus der Ukraine – aus der Stadt Kharkiv, die früh im Krieg auf furchtbare Art Berühmtheit erlangt hat. Julia arbeitet in Longyearbyen in der Nähstube „Systya i Nord“ und stellt dort diese kleinen Herz-Anstecker in den Farben der Ukraine her. Der gesamte Nettoerlös kommt der Ukraine zugute – und man bekommt ein kleines, aber sichtbares Zeichen der Empathie für die Opfer des Krieges. Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit gibt es hier im Spitzbergen.de-Onlineshop. Sehr begrenzte Anzahl!
Erstmals Zollkontrollen auf Spitzbergen – wegen Krieg in der Ukraine
Aufgrund der speziellen Regelungen des Spitzbergenvertrages sind Steuern auf Spitzbergen stark reduziert. So wird keine Mehrwertsteuer erhoben und auch kein Einfuhrzoll. Daher hat sich bisher auch die Notwendigkeit von Zollkontrollen erübrigt, die es entsprechend bislang nicht gegeben hat.
Das wird sich wohl schon im Mai ändern.

Am Gepäckband im Flughafen von Longyearbyen gibt es bislang keinen Zoll,
sondern nur einen Eisbären.
Das soll sich jetzt ändern (aber der Eisbär bleibt).
Der Hintergrund ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die in diesem Zusammenhang verhängten internationalen Sanktionen. Norwegen will verhindern, dass Spitzbergen von Russland als logistisches Schlupfloch genutzt werden kann, um Güter nach Russland zu bringen, die auf Sanktionslisten stehen. Das ist bislang denkbar, weil die Einfuhr nach Spitzbergen eben nicht durch den Zoll kontrolliert wird und es Schiffsverkehr zwischen der russischen Siedlung Barentsburg und Russland gibt.
Das soll sich nun bald ändern. Der norwegische Zoll erhält von der Regierung Auftrag und Mittel, um in Longyearbyen eine Präsenz zu etablieren und wo nötig Zollkontrollen durchzuführen, wie der norwegische Sender NRK berichtet. Schon ab Anfang Mai soll es erstmals in Spitzbergens Geschichte Zollkontrollen geben.
Die Zollkontrollen in Spitzbergen soll es aber wohl nicht dauerhaft geben, sondern nur, so lange der Bedarf gesehen wird.
Behörden planen Eisbären-Warnapp
Norwegische Behörden haben angekündigt, in Zusammenarbeit mit dem Norwegischen Polarinstitut und mithilfe des Satelliten-Kommunikationssystems Starlink von Elon Musk ein öffentlich zugängliches Eisbären-Warnsystem zu installieren.
In einer ersten Projektphase werden sämtliche Eisbären in Spitzbergen mit von Bill Gates zur Verfügung gestellten Mikrochips versehen. Diese senden regelmäßig Signale, die von den Starlink-Satelliten aufgefangen und über Bodenstationen in Echtzeit dem Polarinstitut zur Verfügung gestellt werden, so dass die Position sämtlicher Eisbären Spitzbergens jederzeit bekannt ist.

Eisbärin mit Sender älterer Bauart. Von den neuen, viel kleineren Sendern erhofft man sich auch einen erheblichen Komfortgewinn für die Tiere.
Der Öffentlichkeit wird keinen unmittelbaren, vollständigen Zugang zu dieser Datenbank haben, aber Nutzer können sich eine App installieren und sich nach dem Vorbild der Corona-Warnapp informieren lassen, wenn sich ein Eisbär in der Nähe aufhält. Nutzer der zu bezahlenden Pro-Version der App können über eine spezielle Funktion den im Ohr des Eisbären angebrachten Chip blinken lassen, um die Sichtbarkeit der potenziellen Gefahr zu erhöhen – vor allem in der Polarnacht ein sehr nützliches Feature. In jedem Fall soll die App bei Nahkontakten unterhalb von 5 Metern Entfernung ein unüberhörbares Warnsignal von sich geben.
Perspektivisch wird angestrebt, dass man das Verhalten der Eisbären zumindest im Notfall per App über die Chips fernsteuern kann, um etwa schlechtgelaunte Eisbären von aggressiven Vorhaben abzubringen.
Eine erste Version wird derzeit getestet. Die Veröffentlichung der App ist für den 1. April 2222 geplant – ab dann nicht hier im Spitzbergen.de-Shop!
Margas Arktis-Fernsehtipps für den April
Hier kommen Margas arktische Fernsehtipps für den April 2022. Nach den heftigen Warmwettereinbrüchen von Mitte März, die bemerkenswerterweise (aber doch zufällig) in Teilen der Arktis und Antarktis jeweils praktisch gleichzeitig auftraten, hat das Wetter sich zumindest in Spitzbergen erst mal wieder stabilisiert und einen schönen Lichtwinter gebracht. Hoffen wir, dass es noch eine Weile so bleibt, bis irgendwann im Mai die Schneeschmelze kalendergerecht einsetzt. Dann sollte man bis dahin nicht wirklich einen Fernseher brauchen. Und falls doch – hier sind die passenden Programmvorschläge:

Arktis Fernsehtipps: Der Fernseher in der Ritterhütte auf Gråhuken.
Der Empfang ist dort mitunter allerdings eher schlecht.
Die Listen werden bei Bedarf aktualisiert. Sachdienliche Hinweise werden von jeder Spitzbergen.de-Dienststelle entgegengenommen.
Margas Arktis-Fernsehtipps auf Arte im April
- Freitag, 01.04., 19.40 Uhr: „Sibirien taut auf: Klimawandel im Permafrost“ (Reportage, D 2020)
- Montag, 04.04., 12.25 Uhr: „Sibirien taut auf“ (Wiederholung von Freitag)
- Montag, 11.04., 09.45 Uhr: „Die Schlammfussballer von Island“ (GEO Reportage, D 2016)
- Sonntag, 17.04., 08.45 Uhr: „Wenn Wale uns den Weg weisen“ (F 2019)
- Mittwoch, 20.04., 19.40 Uhr: „Der Krieg um den Wildfisch: Auf einem Trawler vor den Färöer- Inseln“ (Reportage, F 2021)
- Donnerstag, 21.04., 12.25 Uhr: „Der Krieg um den Wildfisch: …“ (Wiederholung von Mittwoch)
EA = Erstausstrahlung.
Margas Arktis-Fernsehtipps auf anderen Programmen bis zum 8. April
Einleitend heißt es hier etwas kryptisch: „Genaue Sendetitel bitte tagesaktuell anschauen, deutet alles auf Island hin“. Dazu kommt nun ergänzend die Info: „ist nicht alles Island …“ 🙂
- Alle hier stehenden Sendungen laufen am Dienstag, dem 05.04., auf 3sat, und wie erwähnt wird gemutmaßt, dass die Sendungen mit Island zu tun haben 🙂
- 13.20 Uhr: Steffens entdeckt Grönland
- 14.05 Uhr: Island – Weltspitze
- 14.50 Uhr: Inselträume (Island)
- 15.35 Uhr: Traumorte (Norwegen)
- 16.15 Uhr: Unterwegs am Polarkreis
- 17.00 Uhr: Nordlichter (von Spitzbergen bis …)
- Donnerstag, 14.04., 20.15 Uhr, NDR: „Norwegens Sehnsuchtsstraße (1+2): 3000 km Richtung Norden“ (D 2018)
- Montag, 25.04., 20.15 Uhr, 3sat: „Feuer und Eis – Die magischen Inseln der Wikinger“ (A 2019)
Alle Angaben wie immer ohne Gewehr.
… schlechte Zeiten: Regen, Tauwetter und Schneeschmelze im Winter
Nun, „schlechte Zeiten“ ist natürlich relativ. Hier fallen keine Schüsse und Bomben. Uns geht es gut. Es fällt nur Regen. Davon aber viel zu viel, und ein großer Teil der Schönheit um uns herum ist in den letzten Tagen weggeschwommen.
Ein kräftiges Tiefdruckgebiet saugt warme Luft aus dem Süden an und pumpt sie nach Norden. Diese Luft bringt Wind, Feuchtigkeit und Wärme mit sich. Von allem deutlich mehr, als man gerne hätte.
Unsere kleine Welt hier oben schmilzt.

Longyearbyen: Bäche mit Regen- und Schmelzwasser laufen über die Straßen.
Das war zumindest über Tage hinweg der Eindruck, den man bekam, gleich wohin man schaute. Wasser fiel vom Himmel, Wasser färbte den Schnee erst grau, dann dunkel und verwandelte ihn schließlich vielerorts in kleine Seen auf der Tundra. Wasser brach sich Bahn in Bächen und Flüssen, die eigentlich noch monatelang gefroren sein sollten.
Für einen kleinen Gang nimmt man am besten Gummistiefel, schnell versinkt man bei einem falschen Tritt auch im Ort weit über den Knöchel hinaus im Schneesumpf. Einen Schritt weiter kann es allerdings spiegelglatt sein. Überall gibt es seifenglatte Eisflächen, gerade auch auf den Straßen und Wegen im Ort. Die in Norwegen weit verbreiteten Spikes sind eine ganz hervorragende Erfindung, die sicher schon unzählige schwere Stürze verhindert haben.

In Longyearbyen mussten Abflüsse für Bäche und Flüsse freigelegt werden, um Überschwemmungen zu verhinden. Im Mai oder Juni ist das Routine, im März aber sehr ungewöhnlich.
Wer hinaus will in die winterliche Arktis, wartet besser, bis sie wirklich wieder winterlich ist. Es steht außer Frage, dass es wieder kälter werden wird. Der Winter ist nicht vorbei, er macht nur Pause. Die Flüsse werden wieder zufrieren, aus den Seen werden glatte, solide Eisflächen werden.
Die Frage ist, ob und wann noch mal genügend Schnee fällt, um die so löchrig gewordene weiße Decke wieder zu flicken. Das ist zu hoffen, im Interesse all jener, die in den nächsten Wochen hier Tourenpläne haben. Und das sind im März und April sehr viele.

Aus Motorschlittenrouten werden Sümpfe und Seen im Schnee. Wer jetzt noch fährt, riskiert steckenzubleiben und die Vegetation unter dem geschmolzenen Schnee zu beschädigen.
Bis die Schneeschmelze dann irgendwann im Mai kalendergerecht diesen Winter beenden wird.

Es ist aus gutem Grund verboten, abseits der Wege auf nicht gefrorenem, nicht aufgetautem Untergrund zu fahren. Manche gehen mit diesem klaren Verbot am Saisonende oder in Tauwetterphasen recht liberal um, um es höflich zu formulieren. Das Ergebnis bleibt viele Jahre lang sichtbar, wie hier im Bild (Adventdalen neben der Straße, Bild von Juni 2019).
Die heute wohl unvermeidliche Frage: ist das jetzt Wetter oder Klimawandel? Meine kurze Antwort: sowohl als auch. Ohnehin sind Wetter und Klima ja nicht wirklich voneinander zu trennen, es handelt sich um verschiedene zeitliche Perspektiven auf das gleiche Sammelsurium an Phänomenen, die zusammen den Zustand der Atmosphäre vor allem in Bodennähe beschreiben. Temperatur, Niederschlag, Wind, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, um die wichtigsten zu nennen. Wetter ist das, was man hier und jetzt sehen, fühlen und messen kann. Klima ist das, was über Jahrzehnte daraus wird. Mittelwerte, Tendenzen und so. Nicht unmittelbar messbar, aber mittels statistisch aufbereiteter Messdaten erfassbar.
Im konkreten Einzelfall ist es sehr schwer zu sagen, ob es ohne den Klimawandel auch eingetreten wäre. Hier hat die Wissenschaft in den letzten Jahren einige Fortschritte gemacht, und es wäre interessant zu hören, was ein Fachwissenschaftler zu dem aktuellen Warmlufteinbruch sagen würde.
Erst mal kann man nur Vermutungen anstellen auf Basis der bekannten Tendenzen. Und die sind klar: weniger stabile, häufiger wechselnde Wetterlagen, häufigere Stürme und mehr Niederschlag ist das, was der Klimawandel in die maritim geprägte Arktis im Nordatlantik bringt. Tauwettereinbrüche auch im tiefsten Winter gab es im Einzelfall auch früher schon, aber ihre Häufigkeit und Intensität ist in jüngerer Vergangenheit gestiegen und diese Tendenz wird sich wohl fortsetzen.
Die Wahrscheinlichkeit ist also wohl sehr hoch, dass es den aktuellen Warmlufteinbruch so ohne den Klimawandel nicht gegeben hätte, beziehungsweise dass er viel weniger intensiv ausgefallen wäre. Ohne tagelangen Regen bei Temperaturen um 5 Grad plus.
Auch Einheimische, die hier schon viele Winter erlebt haben, schauen mit Befremden und mehr oder weniger entsetzt auf das große Schmelzen. Und wer sich gerade diese Tage ausgesucht hatte, um den Winter in der Arktis zu erleben, hat wirklich maximales Pech.
- Galerie-Anker-Link: #galerie_2192
Klicken Sie auf die Bilder, um eine vergrößerte Darstellung des Bildes zu erhalten.
Shackletons Endurance gefunden
Mit Spitzbergen hat das wirklich nichts zu tun, aber die Geschichte ist zu groß und zu gut, um nicht ausnahmsweise dennoch erwähnt zu werden – und wer freut sich nicht gerade in diesen Zeiten über eine gute Nachricht?
Also: Nach mehrjähriger Suche ist das Wrack der berühmten Endurance gefunden worden! Ein großer Glückwunsch an die Expedition des Falklands Maritime Heritage Trust (FMHT) auf dem südafrikanischen Eisbrecher Agulhas II!

Nach 107 Jahren gefunden: Das Wrack der Endurance.
Foto © Falklands Maritime Heritage Trust (FMHT).
Die Endurance war das Schiff, mit dem Shackleton von Südgeorgien aus 1914 im inneren Weddellmeer die Küste der Antarktis erreichen wollte, um von dort aus den Kontinent über den Südpol zum Rossmeer zu queren. Daraus wurde bekanntlich nichts. Die Endurance sank im November 1915 nach einer langen Drift im Eis im westlichen Weddellmeer. Dennoch überlebten alle Teilnehmer das epische Abenteuer, das seitdem zu den berühmtesten Überlebensgeschichten der Polargebiete gehört. Die Fahrt nach Elephant Island, der Aufenthalt dort, die Weiterfahrt einer kleinen Gruppe nach Südgeorgien in einem der Rettungsboote, die Querung Südgeorgiens, die anschließende Rettung der übrigen Mannschaft auf Elephant Island – das ist heute alles Legende. Allergrößtes Kino!
107 Jahre später wurde das Wrack in gut 3000 Metern Tiefe nun gefunden. Mit ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen wurden Fotos und Videoaufnahmen gemacht, die den erstaunlich guten Erhaltungszustand dokumentieren. Das Wrack erscheint weitgehend intakt und steht aufrecht. Holzfressende Organismen gibt es im Weddellmeer nicht, im Gegensatz zu allen anderen Weltmeeren außerhalb des Südpolarmeers. Geborgen wurde nichts, und das ist auch nicht geplant. Das Wrack steht unter strengem Schutz.
Der Fund hat in kurzer Zeit weltweite mediale Aufmerksamkeit erregt. In diesem Beitrag der BBC etwa ist auch eine Videoaufnahme des Wracks zu sehen.
News-Auflistung generiert am 09. Mai 2025 um 19:10:23 Uhr (GMT+1)