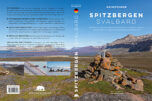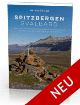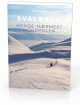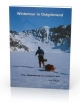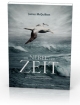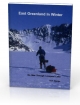-
aktuelle
Empfehlungen- Spitzbergen unter Segeln 2025
Kurs Arktis im Sommer 2025
- Spitzbergen-Reiseführer
Aktualisierte Neuauflage 2025
- Spitzbergen unter Segeln 2025
Kurs Arktis im Sommer 2025
Seitenstruktur
-
Nachrichten
- Monat auswählen
- Mai 2025
- April 2025
- März 2025
- Februar 2025
- Januar 2025
- Dezember 2024
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- April 2024
- März 2024
- Februar 2024
- Januar 2024
- Dezember 2023
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- August 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- Februar 2022
- Januar 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- Oktober 2021
- September 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- April 2021
- März 2021
- Februar 2021
- Januar 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- September 2020
- August 2020
- Juli 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- April 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Januar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- Oktober 2019
- September 2019
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- Januar 2019
- Dezember 2018
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- August 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Januar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Juli 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012
- März 2012
- Februar 2012
- Januar 2012
- Dezember 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- August 2011
- Mai 2011
- April 2011
- März 2011
- Februar 2011
- Januar 2011
- Dezember 2010
- November 2010
- September 2010
- August 2010
- Juli 2010
- Juni 2010
- Mai 2010
- April 2010
- März 2010
- Februar 2010
- November 2009
- Oktober 2009
- September 2009
- August 2009
- Juli 2009
- Juni 2009
- Mai 2009
- April 2009
- März 2009
- Februar 2009
- Januar 2009
- Dezember 2008
- November 2008
- Oktober 2008
- August 2008
- Juli 2008
- Juni 2008
- Mai 2008
- April 2008
- März 2008
- Februar 2008
- April 2000
- Monat auswählen
-
Wetterinformationen
-
Newsletter

| Spitzbergen-Reiseführer: Neuauflage ist da 🤩 |
Home →
Jahres-Archiv: 2014 − Nachrichten
Wieder Granatenfund bei Longyearbyen
Wieder, wie bereits in vergangenen Sommer, wurde Munition aus dem zweiten Weltkrieg bei Longyearbyen gefunden. Diesmal lagen die Granaten auf dem Plateauberg, der sich unmittelbar an der westlichen Seite der Stadt erhebt. Das Areal wurde weitläufig abgesperrt. Die Granaten konnten entschärft werden.
Platåfjellet
Quelle: Sysselmann
Wieder Eisbär in Fischernetz verheddert
Im Juli war im Norden Spitzbergens eine Eisbärin mit einem um den Hals verwickelten Fischernetz gesichtert worden; die Bären konnte später betäubt und von ihrer Last befreit werden (siehe Spitzbergen.de-Nachrichten vom Juli).
Kurz darauf wurde ein zweiter Fall bekannt, in dem eine Eisbärin in einem Fischernetz verhakt war. Dieser zweite Fall ist insofern doppelt vom Menschen verschuldet, als dass es ein von Wissenschaftlern platzierter Ohrknopf war, an dem sich ein schweres, angeschwemmtes Fischernetz verhakt hatte. Ohrknöpfe dieser Art zeichnen die Länge des Tageslichts auf, was später Aufschlüsse über Wanderungsbewegungen und ggf. Aufenthaltsdauer in einer Schneehöhle um die Geburt von Nachwuchs herum liefern soll.
Die Eisbärin wurde im Sorgfjord von freiwilligen Mitarbeitern während einer Müllsammelfahrt der Verwaltung entdeckt. Sysselmannen und norwegisches Polarinstitut ergriffen umgehend Maßnahmen zur Befreiung der Bärin. Als ein Biologe des Polarinstituts mit dem Betäubungsgewehr auf das Tier anlegt, riss dieses sich los. Der Ohrknopf blieb am Netz zurück. Es gibt keine Spuren einer Verletzung, die Eisbärin scheint wohlauf zu sein.
Mittlerweile wird Kritik an der norwegischen Fischereiflotte laut, die theoretisch verpflichtet ist, den Verlust von Fanggeräten wie Netzen auf See zu melden. Die Fischereiaufsicht (Fiskeridirektorat) ist seit 1980 verpflichtet, Netze möglichst zu bergen, und hat seitdem über 17000 eingesammelt. Über die Zahl der verlorenen Netze gibt es keine Angaben. Die Anzahl der regelmäßig an den Stränden in Spitzbergen und anderswo gesammelten Netze legt allerdings nahe, dass eine erhebliche Menge auf See verloren geht oder möglicherweise illegal über Bord geworfen wird. Seit 2008 können beschädigte Fischernetze kostenlos in norwegischen Häfen entsorgt werden.
Siehe hier für mehr Informationen zur Plastikmüll-Problematik. Auch auf der am 02. August zu Ende gegangenen Reise haben wir wieder mehrere Kubikmeter Müll eingesammelt, vor allem Fischernetze.
Diese Eisbärin war von Wissenschaftlern mit einem Knopf im Ohr ausgestattet worden und hatte sich damit in einem Fischernetz verfangen. © Christian Nicolai Bjørke.
Quelle: Svalbardposten
Suchaktion wegen Problemen mit Satellitenkommunikation
Ende Juli hatten viele Anbieter satellitengestützter Kommunikationsdienste tagelang erhebliche technische Probleme. Dies führte unter anderem zu Verzögerungen beim Arktis-Blog auf dieser Webseite.
Anderswo entstanden jedoch auch ernsthaftere Schwierigkeiten. Schiffe waren mitunter nicht in der Lage, sich mit aktuellen Wetterberichten zu versorgen. Eine französische Segelyacht wurde in Spitzbergen mit Flugzeug gesucht, da verabredete Nachrichten der Segler tagelang ausgeblieben waren. Das Boot wurde bei Smeerenburg gefunden, alle waren wohlauf. Die Übermittlung der Nachrichten war an technischen Schwierigkeiten gescheitert.
Die Probleme lagen tief in der komplexen Technik und waren vom einzelnen Nutzer weder vorhersehbar noch beeinflussbar. Mittlerweile scheinen die Probleme behoben zu sein.
Diese Kommunikationstechnik ist nahezu unzerstörbar, nur leider nicht mobil. Pyramiden, in der Nähe des Hafens.
Quelle: Sysselmannen
Eisbär aus Nylonschlinge befreit
Ein Eisbär, der vor einigen Wochen im Norden Spitzbergens mit einer Nylonschnur um den Hals beobachtet wurde, konnte nun lokalisiert und von Mitarbeitern des Norwegischen Polarinstituts aus der Schlinge befreit werden. Der Fall zeigt anschaulich, welche Gefahr von der zunehmenden Menge angetriebenen Plastikmülls für die Tierwelt der Arktis ausgeht.
Bereits Ende Juni war der Eisbär von Teilnehmern einer Bootstour mit der »Arctica II« im Woodfjord gesehen und fotografiert worden. Sie informierten den Sysselmann, der daraufhin verstärkt nach dem Tier Ausschau hielt und darum bat, es zu melden, sollte der Bär von jemandem gesehen werden. Das dünne Seil, das das Tier um den Hals trug, stammte vermutlich aus der Schleppnetzfischerei. Es hatte sich zu einer festen Schlinge verknotet und das lose Ende hing etwa einen Meter herunter. Glücklicherweise hatte die Schlinge noch genug Spiel um das Tier nicht direkt zu verletzen oder es bei der Atmung zu behindern. Experten des Sysselmanns sahen die größte Gefahr darin, dass der Eisbär in kurzer Zeit viel frisst, falls er z.B. einen Kadaver findet oder eine Robbe erbeutet und dadurch so stark zunimmt, dass die Schlinge ihm den Hals einschnürt und in die Haut schneidet.
Die Wahrscheinlichkeit, ein einzelnes Tier in dem großen, fast menschenleeren Gebiet wieder zu finden, ist prinzipiell eher gering. Daher war es umso erfreulicher, als der Sysselmann am 22. Juli die Meldung bekam, dass der Bär in der Nähe der Trapperstation auf Austfjordnes, im inneren Wijdefjord, gesehen wurde. Noch am gleichen Tag flogen Mitarbeiter des Norwegischen Polarinstituts mit dem Helikopter dorthin. Sie konnten den Bären lokalisieren und betäuben. Nachdem sie die Schlinge entfernt und den Eisbären untersucht hatten, vergewisserten sie sich, dass er wieder aufwachte und sich in Bewegung setzte.
Der Eisbär hatte Glück, dass er gefunden wurde, und dass er ein Eisbär war. Für ein Rentier oder für einen einzelnen Vogel hätte man diesen Aufwand nicht betrieben. Gerade einigen Vogelarten droht durch den Plastikmüll eine andere Gefahr: Sie verschlucken kleinere Kunststoffteile, die dann nicht verdaut werden und zum Tod des Tieres führen können. Eine jüngere Untersuchung bei Eissturmvögeln auf Spitzbergen hat ergeben, dass sich bei 90% der Tiere kleine Kunststoffteile im Magen befinden.
Angeschwemmter Müll kann für Tiere zur Falle werden
(Generell zur Plastikmüll-Problematik siehe auch »Oceancleanup: eine Lösung für die Plastikmüll-Schwemme in den Ozeanen« Spitzbergen.de-Nachrichten Juni 2014)
Quelle: Norwegisches Polarinstitut
Rentierzählung auf Spitzbergen: lokaler Bestand weiter angestiegen
Das norwegische Polarinstitut hat die jährliche Zählung des lokalen Rentierbestandes im Adventdalen abgeschlossen und das Ergebnis ist für die Forscher recht überraschend ausgefallen: Wiederum ist der Bestand auf einen Rekordwert angewachsen.
Im Juni zählen Forscher des Norwegischen Polarinstituts den Rentierbestand im Adventdalen und in den anliegenden Seitentälern. Dort wurden in diesem Jahr knapp 1500 Tiere gezählt, fast 300 mehr als im letzten Jahr, in dem der Bestand bereits auf ein Rekordniveau angewachsen war. Eine zweite, von der Universität in Tromsø durchgeführte Zählung bestätigt das Ergebnis. Aufgrund des relativ hohen Anteils an Alttieren im letzten Jahr, war in diesem Jahr nicht mit einem Anstieg der Population gerechnet worden. Die Forscher zählten jedoch überraschend viele Kälber, über 300, und auf der anderen Seite war die Anzahl der verendeten Tiere sehr gering. Es wurden lediglich 20 Kadaver gefunden, in schlechten Jahren waren es zwischen 100 und 200.
Als Ursache für den erneuten Anstieg der Population werden günstige klimatische Bedingungen vermutet, die den Tieren bessere Weidemöglichkeiten bescherten. Bereits im letzten Sommer hatten hohe Temperaturen für gutes Futterwachstum gesorgt, sodass die Tiere für die kalte Jahreszeit gerüstet waren. Da der vergangene Winter auf Spitzbergen dann relativ mild verlaufen war, dürfte das Futter wiederum leichter zugänglich gewesen sein. Üblicherweise führen mildere Winter mit gelegentlichen Regenperioden zur Vereisung und damit zur Versiegelung der Oberflächen, was die Futteraufnahme für die Tiere erschwert. Im vergangenen Winter hatte es zwar geregnet, doch war dieser negative Effekt offenbar ausgeblieben. Besonders an den steileren Hängen der Täler hatte der Regen die Vegetation wohl eher ganz frei gelegt.
Seit Beginn der Rentierzählungen im Adventdalen im Jahr 1979 wurden immer wieder natürliche Schwankungen im Bestand registriert. Ein Anwachsen der Population kann im folgenden Jahr zu erhöhter Futterkonkurrenz führen, ein Effekt, der durch ungünstige klimatische Bedingungen verstärkt wird. Nach starken Anstiegen der Population in den letzten beiden Jahren rechnen die Forscher daher nun wieder mit einem stärkeren Rückgang im kommenden Winter.
Rentiere im Adventdalen
Quelle: Svalbardposten
Arktis-Blog: Jan Mayen, Spitzbergen
Erleben Sie von zu Hause Reisen nach Jan Mayen und um Spitzbergen mit! Rolf Stange wird während des arktischen Sommers mehr oder regelmäßig kleine Reiseberichte aus dem hohen Norden als Blog veröffentlichen. Unterhaltsame Schilderungen und Eindrücke von spannenden Reisen aus erster Hand gibt es hier: Spitzbergen.de Arktis-Blog: Jan Mayen, Spitzbergen.
Anflug auf Ísafjörður: Beginn des Jan Mayen Abteneuers.
MS Langøysund im Verdacht auf Dumpinglöhne
Seit vielen Jahren ist die MS Langøysund ein beliebtes Boot für Tagestouren im Isfjordgebiet. Von Juni bis September fährt das Schiff mit bis zu etwa 70 Gästen nach Barentsburg oder Pyramiden, auch die Vorbeifahrt an landschaftlichen Schönheiten wie einer Gletscherfront oder einem Vogelfelsen steht auf dem Programm.
Dieses Jahr läuft es aber bislang nicht gut für die Langøysund. Zu Saisonbeginn lief das Schiff in der Borebukta auf Grund. Der Rumpf wurde beschädigt, die Gäste mussten die Fahrt nach Longyearbyen mit einem anderen Schiff fortsetzen. Immerhin dauerte es nicht lange, bis der Schaden repariert und das Schiff für die weitere Fahrt freigegeben war.
Nun steht der Eigner, die Firma Henningsen Transport og Guiding (HTG) aus Longyearbyen, wegen Sozialdumping im Verdacht. Bereits im April hatte die Seefahrtsgewerkschaft (Norsk Sjømannsforbund) eingreifen müssen, damit die teilweise aus Philippinern bestehende Mannschaft norwegische Verträge mit norwegischen Tarifen bekommt, wie es auf Schiffen vorgeschrieben ist, die unter norwegischer Flagge fahren.
Nun stellte sich bei einer Kontrolle in Longyearbyen heraus, dass die Mannschaft zwar norwegische Verträge bekommen hat, aber nach wie vor deutlich geringere Löhne erhält, als ihnen nach Vertrag und Gesetz zusteht.
Bei HTG beruft man sich darauf, dass der Vertragspartner der Mannschaft eine philippinische Agentur in Manila ist, der man vertraue und der man die Löhne überweise.
Die Zusammenarbeit mit den betroffenen Mannschaftsmitgliedern gestaltet sich für die Gewerkschaft schwierig, da diese Angst haben, bei der Vermittlungsagentur auf eine schwarze Liste zu kommen, selbst wenn ihnen nach norwegischem Recht deutlich höhere Löhne zustehen. Die Rede ist von 5000 US-$ Lohn zuzüglich bezahlter Überstunden, was im harten Tagestourengeschäft einen wesentlichen Anteil ausmachen dürfte. Tatsächlich sollen die Löhne bei etwa 1500 US-$ liegen, wovon die Vermittlungsagentur in Manila noch einmal 20 % einkassiert.
Der Eigner, HTG, äußerste gegenüber der Svalbardposten, dass Verträge und Löhne in Ordnung seien und man nicht daran denke, die Zahlungen nachzuweisen. Nachdem diesbezüglich am heutigen Donnerstag eine Frist abgelaufen war, wurde angekündigt, die Langøysund in „Arrest“ zu legen.
Ähnliche Vorwürfe wurden gegenüber der MS Billefjord laut, wo HTG ebenfalls das Management bestreitet, wenn auch nicht als Eigner. Auch hier wurde von der Gewerkschaft schon ein Eingreifen angekündigt.
MS Langøysund auf Tagestour in der Ymerbukta. Werden der Mannschaft illegale Dumpinglöhne gezahlt?
Quelle: Norsk Sjømannsforbund
Surge der Austfonna Eiskappe: Zeitraffer-Video
Teile von Austfonna, der großen Eiskappe auf dem Nordaustland, sind in den letzten Jahren kräftig vorgestoßen, siehe hierzu Austfonna: Eine Eiskappe setzt sich in Bewegung (Spitzbergen.de-Nachrichten Juni 2014).
Das Norwegische Polarinstitut hat ein Video aus etwa 1000 Einzelbildern von Satelliten zusammengestellt und auf Youtube veröffentlicht. Es zeigt auf beeindruckende Weise, wie Teile der Gletscherfront von Austfonna über 4 Kilometer vorrücken. Die beschleunigte Bewegung hatte 2012 ihren Höhepunkt.
Mehr zum plötzlichen Vorstoßen von Gletschern (Surge) und zur Eiskappe Austfonna in Steine und Eis.
Das Vorstoßen einer so großen Eiskappe wie Austfonna hat Folgen: Einerseits trägt Austfonna derzeit mehr zum Meeresspiegelanstieg bei als alle anderen Gletscher Spitzbergens zusammen. Lokal führte der „Surge“, wie das beschleunigte Vorstoßen neudeutsch-wissenschaftlich heißt, schon zu Warnungen für die Schifffahrt: Es muss sowohl mit einer größeren Zahl von Eisbergen gerechnet werden als auch mit Veränderungen des Meeresbodens, der unter Wasser zu Stauchendmoränen aufgeschoben sein kann.
Zeitraffer-Video aus etwa 1000 Einzelbildern vom Surge (Vorstoß) der Eiskappe Austfonna (© Norwegisches Polarinstitut, Screenshot). Hier klicken für das Video auf Youtube.
Quelle: Norwegisches Polarinstitut
Fredheim: Spitzbergens berühmteste Trapperhütte als virtuelle Tour
Spitzbergens berühmteste Trapperhütte, Fredheim im Tempelfjord, ist jetzt als virtuelle Tour zugänglich. Die zweigeschossige Hütte des legendären norwegischen Jägers Hilmar Nøis liegt landschaftlich schön, aber außerhalb der winterlichen Motorschlittensaison schwer erreichbar, und wer es dorthin schafft, steht vor verschlossener Tür.
Jetzt lässt sich die berühmte Hütte rund ums Jahr ganz ohne Aufwand vollständig besichtigen: Ende März konnte ich Fredheim vollständig mit Panoramatechnik fotografieren und habe daraus eine virtuelle Tour gemacht, die jetzt online ist und den Besuch jederzeit ermöglicht, Raum für Raum. Die Tour läuft wie ein Film von alleine ab; es ist aber auch möglich, die einzelnen Räume (Panoramen) einzeln anzuwählen. Kurze Texte erzählen die zugehörigen Geschichten aus der Trapperzeit in Spitzbergen.
Die Lokalzeitung Svalbardposten hat ihre Leser in ihrer Online-Ausgabe bereits auf die Möglichkeit hingewiesen, Fredheim im Internet zu besuchen. Schon über 1000 Besucher hat die alte Trapperhütte seitdem virtuell zu verzeichnen, deutlich mehr als der „Tag der offenen Tür“, der während der Wintersaison zweimal vor Ort abgehalten wird: Die einzige Gelegenheit für die Öffentlichkeit, einen Blick in das Innenleben von Hilmar Nøis alter Hütte zu werfen.
Viel Spaß – hier geht’s nach Fredheim 🙂
Fredheim, die berühmte Trapperhütte von Hilmar Nøis im Tempelfjord, ist schwer erreichbar und abgeschlossen. Virtuell kann man jetzt jederzeit durch alle Räume gehen.
Oceancleanup: eine Lösung für die Plastikmüll-Schwemme in den Ozeanen
Die Umweltprobleme, die für Polargebiete tatsächlich existenzbedrohend sind, lassen sich recht gut eingrenzen: neben dem Klimawandel und langlebigen Umweltgiften sowie regional der Öl- und Gasindustrie sind es die gewaltigen Mengen Plastik, die in den Weltmeeren driften und selbst die entlegenen Regionen erreichen. In Spitzbergen sehen wir nahezu täglich Plastikmüll an den Stränden liegen oder im Meer treiben. Vieles davon stammt aus der Fischerei: Riesige Netze, Plastikseile, bunte Netzbälle, Fender, um nur einige Beispiele zu nennen. Darüber hinaus ist es aber auch der alltägliche Zivilisationsmüll, von Feuerzeugen über Zahnbürsten, endlose Mengen von Plastiktüten, die man bei jedem Einkauf fast aufgedrängt bekommt (vermutlich da es sich um Werbeträger handelt), Flaschendeckel … die Liste ist endlos. Für ein paar konkrete Eindrücke lohnt sich beispielsweise ein Blick in die Fotogalerie von Chris Jordan (hier klicken), der auf den abgelegenen Midway Islands im Pazifik Albatros-Küken fotografiert hat, die an Plastikmüll gestorben sind.
Auf praktisch jeder Spitzbergen-Reise sammeln wir kubikmeterweise Plastikmüll von den Stränden, was über die letzten 10 Jahre zu deutlich sichtbaren Verbesserungen geführt hat (übrigens ist der Tourismus der einzige Akteur, der die Kapazitäten hat, dies in diesem Umfang in so abgelegenen Gebieten tun zu können. Ein guter Grund, die Bewegungsfreiheit der kleineren Touristenschiffe nicht weiter einzuschränken), angesichts der Größenordnung des globalen Plastikmülls aber natürlich keine echte Lösung sein kann.
Ein paar Eindrücke von den Plastikmüllmengen, die sich an den Stränden in Spitzbergens finden, und von den Müllsammelaktionen, die wir regelmäßig dort machen. Die Fotos stammen von weiten Teilen der Inselgruppe, von der Bäreninsel im Süden bis zum Nordaustland im Norden.
- Galerie-Anker-Link: #galerie_474
Klicken Sie auf die Bilder, um eine vergrößerte Darstellung des Bildes zu erhalten.
Um wirksam gegen den Müll vorzugehen, dem ständig Fische, Seevögel, marine Säuger von Robben bis zu Walen, Schildkröten usw. in dramatischer Zahl und somit letztlich ganze marine Ökosysteme zum Opfer fallen und der (vielleicht noch schlimmer) in zerkleinerter Form die Nahrungskette eingeht, wäre es nötig:
- Viel weniger Plastik im Alltag nur kurz zu Verwenden und anschließend wegzuwerfen. Hier sind wir alle gefragt, gut 7 Milliarden Menschen. Wie wäre es mit einer Baumwolltasche beim nächsten Einkauf, nur so als Anfang?
- Plastik durch abbaubare Materialien zu ersetzen. Hier sind neben Verbrauchern vor allem Industrie, Forschung und Politik gefragt.
- Die in den Ozeanen bereits vorhandenen Riesenmengen Plastik möglichst wieder zu entfernen. Hier wird es gerade spannend: Nach mehreren Jahren Arbeit hat das Projekt The Ocean Cleanup ein Konzept vorgestellt, das es ermöglichen soll, über einige Jahre Plastikmüll in global relevanten Mengen aus den Ozeanen zu entfernen. Kern der Idee ist, Strömungen zu nutzen, damit Plastikmüll sich in Barrieren verfängt, konzentriert wird und dann mit vergleichsweise wenig Aufwand abgeschöpft werden kann. Das Wasser strömt unter den recht flachen Barrieren durch, wodurch auch Beifang von Tieren verhindert werden soll. Anfang Juni wurde ein umfangreicher Bericht veröffentlicht, der die Machbarkeit dokumentiert. Die Kosten werden mit 4,50 Euro pro kg Plastik angegeben, was um den Faktor 33 geringer sein soll als andere Methoden. Über einen Zeitraum von 10 Jahren sollen sich so etwa die gigantischen Müllmengen im riesigen Müllstrudel im Pazifik halbieren lassen, zu Kosten, die im Vergleich zu den Schäden geringfügig sind.
Der Eindruck scheint berechtigt zu sein, dass das The Ocean Cleanup Projekt in der Lage wäre, einen wichtigen Beitrag zur Lösung des ozeanischen Müllproblems zu leisten. Um das Projekt auf die nächste Stufe zu heben, wird aktuell ein Crowdfunding durchgeführt. Derzeit (18.6.) wurde schon über eine halbe Million Dollar gespendet, angestrebt sind 2 Millionen. Spitzbergen.de hat sich bereits beteiligt und ruft dazu auf, The Ocean Cleanup zu unterstützen. Wer den Müll an Spitzbergens Stränden oder sonstwo oder Chris Jordans Fotos aus dem Pazifik gesehen hat, wird das Projekt vermutlich gerne unterstützen. Hier klicken, um The Ocean Cleanup zu unterstützen.
Und beim nächsten Einkauf an eine Baumwolltüte denken … 🙂
Mannschaft und Gäste der SV Antigua bei einer Müll-Sammelaktion in Mushamna im Woodfjord, im Norden von Spitzbergen. Solche Aktionen finden praktisch auf jeder Spitzbergen Reise statt, auch andere Schiffe beteiligen sich.
Quelle: The Ocean Cleanup
Kommunikation in Spitzbergen vorübergehend zusammengebrochen
Eine empfindliche Erinnerung daran, wie abgelegen Spitzbergen weiterhin ist und was für eine Verletzlichkeit dies nach wie vor mit sich bringen kann, bekam man in Longyearbyen am Montag vor knapp 2 Wochen, am 2. Juni, als die gesamte Kommunikation zum Festland für einige Stunden komplett tot war.
Seit über 10 Jahren läuft die Telekommunikation von Spitzbergen zum Festland über Glasfaserkabel, die die davor üblichen Funkverbindungen ersetzt haben. Ein Grund dafür waren und sind die großen Datenmengen, die ständig bei den Empfangsantennen für Satellitendaten um Longyearbyen (SvalSat, die runden Kugeln auf dem Platåberg) anfallen und in Echtzeit Kunden wie NASA und ESA geliefert werden müssen. Seitdem gibt es in Longyearbyen theoretisch auch superschnelles Internet (praktisch ist es teuer und langsam, jedenfalls für normale Menschen).
Dass die Sache einen Haken hat, zeigte sich an besagtem Montag: Der gesamte Datenverkehr zwischen Spitzbergen und der Außenwelt fiel für einige Stunden aus. Grund war ein technischer Fehler in der Anlage in Andenes (Vesterålen), wo das Glasfaserkabel das norwegische Festland erreicht. Theoretisch ist die gesamte technische Infrastruktur doppelt vorhanden, so dass auf Ausfälle umgehend reagiert werden kann. Praktisch versagte dieses Mal schlicht und einfach das gesamte System.
Dies schnitt nicht nur die recht junge und internetaffine Bevölkerung Longyearbyens von dort häufig genutzten Diensten wie Facebook ab, sondern machte es auch unmöglich, Polizei und Rettungsdienste zu erreichen. Das Krankenhaus in Longyearbyen, das bei schwierigen Fällen oft auf medizinische Beratung durch die Uniklinik in Tromsø zurückgreift und Patienten bei Bedarf dorthin transportieren lässt, hatte Schwierigkeiten, mit den entsprechenden Stellen Kontakt aufzunehmen: Die sofort eingesetzten Satellitentelefone funktionieren nur mit freiem Blick zum Himmel, so dass verantwortliche Ärzte zu jedem Gespräch auf die Straße mussten. Zudem ist die satellitengestützte Telefonverbindung ohnehin oft langsam und instabil und in jedem Fall teuer, wie dieser Autor nur zu gut aus eigener, leidvoller Erfahrung weiß. Dazu kam, dass in Longyearbyen mangels anderer Möglichkeiten vielfach Satellitentelefone eingesetzt wurden; diese sind dort in vielen outdoor-affinen Haushalten und vielen Betrieben vorhanden. Daher waren auch diese Verbindungen zeitweise überlastet, so dass noch nicht einmal die satellitengestützte Kommunikation zuverlässig funktionierte.
Der Spuk hatte nach ein paar Stunden ein Ende, machte aber allen vor Ort die Grenzen der Technik klar. Insbesondere Träger lebensnotwendiger Infrastruktur und Bereitschaftsdienste wie Polizei, Rettungsdienst und Krankenhaus sind beunruhigt. Die verantwortliche norwegische Telenor arbeitet zusammen mit Behörden, um dafür zu sorgen, dass sich solche Vorfälle möglichst nicht wiederholen. Vor Ort diskutiert man darüber, zumindest auf wichtigen Verbindungen die guten, alten lokalen Kabel zu erneuern. Eigentlich soll Longyearbyen, das wegen seiner Größe und politischen und technischen Rahmenbedingungen gerne als Aushängeschild genutzt wird, einer der ersten Orte Norwegens werden, in denen die Festnetztelefonie komplett abgeschafft wird. Vielleicht wird jetzt noch einmal anders darüber nachgedacht.
Funktioniert immer: explosions- und brandgeschütztes Grubentelefon (hier im Hafen von Barentsburg). Nur kommt man damit nicht weit.
Quelle: Svalbardposten
Austfonna: Eine Eiskappe setzt sich in Bewegung
Die Eiskappe Austfonna bedeckt große Teile des Nordaustland, der zweitgrößten Insel der Spitzbergen-Inselgruppe. Insgesamt bedeckt die Eiskappe, die genau genommen aus mehreren zusammengewachsenen Eiskappen besteht, gut 8400 Quadratkilometer.
Für längere Zeit galt Austfonna als recht stabil: massive Volumenverluste wie bei vielen anderen Gletschern Spitzbergens und sonstwo in der Arktis fanden nicht statt. Randliche Bereiche wurden langsam dünner, zentrale Teile gewannen an Mächtigkeit hinzu. Bei kleineren Gletschern kennt man so ein Verhalten, wenn es über längere Zeit hinweg andauert, als Surge. Dieses plötzliche Vorstoßen, bei dem ein Gletscher innerhalb von 1-2 Jahren viele Kilometer nach vorn „springen“ kann, ist ein Ergebnis der Gletscherdynamik und unabhängig von Klimaänderungen (mehr dazu in Steine und Eis). Auch Teile von Austfonna haben früher bereits „gesurgt“, wie Bråsvellbreen im südlichen Bereich in den 1930er Jahren.
Nun haben Satellitenbilder deutliche Anzeichen geliefert, dass große Teile der Eiskappe sich in beschleunigte Bewegung versetzt haben. Auf breiter Front schiebt sich die Abbruchkante in die Barentssee vor und bringt große Mengen von Eisbergen hervor. Dadurch liefert Austfonna derzeit einen größeren Beitrag zum Meeresspiegelanstieg als alle anderen Gletscher Spitzbergens zusammen. Dennoch gehen Wissenschaftler, die Austfonna schon länger beobachten, davon aus, dass die Eiskappe mittelfristig eher Masse zulegen wird.
AECO, der Verband von Expeditions-Kreuzfahrten-Veranstaltern in der Arktis, hat bereits zu vorsichtiger Navigation in der Region aufgerufen, da vermehrt mit Eisbergen und Änderungen der Küstenlinie zu rechnen ist.
Ein solches Ereignis, wo eine Eiskappe sich auf tausenden von Quadratkilometern in schnelle Bewegung versetzt, ist für die jüngere Zeit, in der die Region genau wissenschaftlich untersucht wird und regelmäßig touristisch bereist werden kann, einzigartig. Die Beobachtung, die wesentlich auf Daten des europäischen Satelliten Sentinel-1a beruht, ist auch deswegen wissenschaftlich beachtlich, weil der Satellit zur Zeit der Aufnahme noch nicht einmal richtig in der Umlaufbahn angekommen war, aber dennoch bereits in der Lage war, sehr wertvolle Daten zu liefern.
Die Eiskappe Austfonna auf dem Nordaustland hat sich auf großer Fläche in schnellere Bewegung versetzt.
Quelle: BBC News.
Eisbärin Kara wanderte durch die halbe Arktis
Einigen Eisbären (genauer: Eisbärinnen), die jedes Jahr vom norwegischen Polarinstitut mit Sendern ausgestattet werden, kann man schon seit längerem auf einer Internetseite des WWF auf ihren Wanderungen folgen. Oft bleiben die Eisbären über einen Zeitraum in einem mehr oder weniger kleinen Gebiet. Aktuell schlägt aber Eisbärin Kara alle bekannten Rekorde: Sie wurde im Januar 2013 auf einem Gletscher zwischen Hornsund und Hamberbukta (Ostküste) betäubt und mit einem Sender ausgestattet und hat seitdem eine unglaubliche Wanderung von 3703 Kilometern durch die russische Arktis gemacht. Zunächst ging die Reise Richtung Novaya Zemlya und von dort nach Franz Josef Land, ohne aber jeweils Land zu betreten. Das nächste Ziel war die sibirische Inselgruppe Severnaya Zemlja, wo Kara auf Land ging, nachdem sie somit die gesamte Kara-See durchstreift hatte. Anschließend ging es aber wieder weiter, nach Franz Josef Land, wo der Sender aufhörte, Daten zu senden. Möglicherweise ist Kara dort in eine Schneehöhle gegangen und hat Nachwuchs zur Welt gebracht.
Das Weibchen Kara war zur Zeit der Ausstattung mit Sender 13 Jahre alt, 2,2 Meter lang und wiegt 217 kg.
Die Daten von 2014 deuten möglicherweise an, dass die Weibchen aktuell weniger Nachwuchs haben als im langfristigen Mittel: Von 29 Weibchen hatten nur 3 Nachwuchs im zweiten Lebensjahr, normal liegt der Anteil bei gut einem Drittel. Allerdings ist die untersuchte Zahl so niedrig, dass Zufall nicht ausgeschlossen werden kann.
Die Ausstattung mit Sendern ist nicht unumstritten, da durch die Betäubung schon Eisbären zu Tode gekommen sind, nachweislich letztmalig im Herbst 2013 (siehe Spitzbergen.de-Nachrichten Oktober 2013). In einem weiteren Fall vom April 2014 liegt der Verdacht eines Zusammenhangs zwischen dem Tod einer jungen Eisbärin und einer Betäubung zu wissenschaftlichen Zwecken ebenfalls nahe, ein Nachweis steht aber noch aus. In der Frühjahrssaison 2014 wurden in Spitzbergen 73 Eisbären zu wissenschaftlichen Zwecken betäubt und untersucht.
Die Wanderung der Eisbärin Kara: 3703 Kilometer von Spitzbergen durch die russische Arktis. Bildquelle: WWF
Quelle: WWF, Svalbardposten
Arktis-Saison 2014 geht los: Bäreninsel, Jan Mayen, Spitzbergen
Die Arktis-Saison 2014 geht los: Morgen legen wir mit der Antigua in Bodø ab. Es geht zu den Lofoten und dann nach Norden zur Bäreninsel und nach Spitzbergen. Im Juli geht es nach Jan Mayen und bis September folgen mehrere Segelschifftouren in Spitzbergen.
Die Fotogalerien und Reiseberichte werden über die nächsten Monate hinweg also wieder regelmäßig aktualisiert werden, reinschauen wird sich garantiert lohnen!
Am Anfang eines langen Arktis-Sommers 2014 stehen die Lofoten. Die Antigua im Trollfjord, 2013.
Neues zur Evolution der Eisbären
Die Evolution der Eisbären ist nach wie vor eine Frage mit vielen Fragezeichen. Viel ist spekuliert worden, von einem sehr jungen Alter von bis zu 100.000 Jahren bis hin zum Vielfachen davon, was die Entstehung der Art tief zurück in frühe Phasen des letzten Eiszeitalters stellen würde (siehe auch „Eisbär als Art älter als bislang gedacht“ Spitzbergen.de-Nachrichten April 2012).
Eine neue Studie basiert auf genetischen Untersuchungen heutiger Eisbären und kommt zu dem Schluss, dass Eisbären sich vor 479.000–343.000 Jahren von den Braunbären getrennt haben, was im Rahmen der Unsicherheit etwa mit den Ergebnissen von 2012 (link oben) übereinstimmt. Somit sammeln sich Hinweise darauf, dass der Eisbär im mittleren Pleistozän (2,6 Millionen-10.000 Jahre vor heute) entstanden ist.
Die Frage ist nicht nur akademisch, sondern auch aktuell von Bedeutung: wäre der Eisbär als Art jünger als 100.000 Jahre, dann wäre die derzeitige Warmzeit die erste, mit der die Art konfrontiert wird, so dass jede weitere Erwärmung Eisbären als Art tatsächlich vor neue Herausforderungen stellen würde. Geht das Alter der Art aber deutlich darüber hinaus, lässt sich schlussfolgern, dass Eisbären als Art schon eine oder mehrere frühere Warmzeiten überlebt haben, was eine entsprechende Anpassungsfähigkeit der Art nahelegt, zumindest im Rahmen der bisherigen Entwicklung. Die jüngeren Ergebnisse bestätigen letztere Sichtweise. Eine Garantie für ein Überleben der Art bei noch stärkeren oder noch schnelleren Erwärmungen ist dies natürlich nicht.
Die Rekonstruktion der Evolution der Eisbären ist auch daher so schwierig, da Fossilien der in jedem Fall geologisch jungen Art meistens unauffindbar im Meer verloren gehen, da Eisbären dort einen großen Teil ihres Lebens verbringen und somit dort auch häufig sterben.
Eisbären: ihre Evolution reicht vermutlich mehrere Jahrhunderttausende zurück. Und das Bild ist aus Spitzbergen, nicht aus dem Zoo.
Quelle: Cell
News-Auflistung generiert am 09. Mai 2025 um 21:37:06 Uhr (GMT+1)