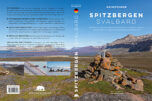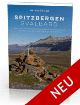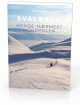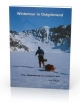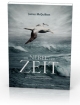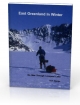-
aktuelle
Empfehlungen- Spitzbergen unter Segeln 2025
Kurs Arktis im Sommer 2025
- Spitzbergen-Reiseführer
Aktualisierte Neuauflage 2025
- Spitzbergen unter Segeln 2025
Kurs Arktis im Sommer 2025
Seitenstruktur
-
Nachrichten
- Monat auswählen
- Mai 2025
- April 2025
- März 2025
- Februar 2025
- Januar 2025
- Dezember 2024
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- April 2024
- März 2024
- Februar 2024
- Januar 2024
- Dezember 2023
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- August 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- Februar 2022
- Januar 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- Oktober 2021
- September 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- April 2021
- März 2021
- Februar 2021
- Januar 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- September 2020
- August 2020
- Juli 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- April 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Januar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- Oktober 2019
- September 2019
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- Januar 2019
- Dezember 2018
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- August 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Januar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Juli 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012
- März 2012
- Februar 2012
- Januar 2012
- Dezember 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- August 2011
- Mai 2011
- April 2011
- März 2011
- Februar 2011
- Januar 2011
- Dezember 2010
- November 2010
- September 2010
- August 2010
- Juli 2010
- Juni 2010
- Mai 2010
- April 2010
- März 2010
- Februar 2010
- November 2009
- Oktober 2009
- September 2009
- August 2009
- Juli 2009
- Juni 2009
- Mai 2009
- April 2009
- März 2009
- Februar 2009
- Januar 2009
- Dezember 2008
- November 2008
- Oktober 2008
- August 2008
- Juli 2008
- Juni 2008
- Mai 2008
- April 2008
- März 2008
- Februar 2008
- April 2000
- Monat auswählen
-
Wetterinformationen
-
Newsletter

| Spitzbergen-Reiseführer: Neuauflage ist da 🤩 |
Home →
Jahres-Archiv: 2014 − Nachrichten
Forschungsfahrt in die Polarnacht: Leben im Eismeer in der Dunkelheit
Wie auch sonst so viel in der Arktis, ist die Forschung im höchsten Norden größtenteils stark saisonorientiert. Wissenschaft findet zum großen Teil im Sommer statt, wenn die Arbeitsbedingungen einfacher sind – immer noch schwierig genug, aber kein Vergleich zur Polarnacht, die Tätigkeiten im Freien mit Dunkelheit, Kälte und Stürmen oft unangenehm und manchmal gefährlich macht.
Ähnlich würde es sicher auch bei den Tieren sein. Dass Eisbären keinen Winterschlaf halten und Rentiere ebenfalls auch in der dunkelsten Zeit nach Futter suchen, war bekannt, aber ansonsten nimmt alles Reißaus, und wer nicht verschwinden kann, würde seine Aktivität bis hin zum Stoffwechsel auf ein Minimum zurückfahren. So dachte man jedenfalls, mangels besseren Wissens und bislang ohne die Möglichkeit, diese Annahme zu überprüfen.
In der nun vergangenen Polarnacht hat das norwegische Forschungsschiff Helmer Hanssen (früher Jan Mayen) eine ausgiebige Forschungsfahrt im Kongsfjord gemacht, um diese lange geglaubten Vermutungen zu überprüfen.
In Zeiten eines normalen Tag-Nacht Rhythmus bewegt sich das Plankton nachts zum Futtern zur Oberfläche hin, um tagsüber wieder in die Dunkelheit der Tiefe und damit in Sicherheit vor Fressfeinden zu verschwinden. Dieses regelmäßige Pendeln zwischen dem nahrungsreichen Oberflächenwasser und der Dunkelheit der Tiefe ist die größte natürliche Bewegung von Biomasse, die es auf der Erde gibt. Eine der Fragen war, ob es eine vergleichbare Bewegung auch während der Polarnacht gibt. Auch wenn es auf diese wie auch auf andere Fragen noch keine abschließenden Antworten gibt, ist doch schon jetzt klar, dass die Aktivität im Polarmeer auch in der dunklen Zeit viel größer ist als bislang gedacht. Offenbar ist etwa Fisch weniger als angenommen vom Licht abhängig, um Beute zu finden. Das zeigt der Mageninhalt von Fischen, die während der Fahrt der Helmer Hanssen gefangen wurden. Darunter befanden sich Beutetierchen, die nicht ohne ein gewisses Maß an Sehfähigkeit gefangen werden können. Möglicherweise können diese Fische also auch in der Dunkelheit besser sehen, als bislang gedacht. Untersuchungen der Augen gefangener Fische sollen zeigen, wie diese Fähigkeit zu erklären ist.
Mit großem Gerät wurden vertikale Wanderungen beobachtet, also die Bewegung zur Oberfläche und in die Tiefe. Die Vermutung, das polarnächtliche Meer sei ein ziemlich schläfriger Ort, kann man schon jetzt getrost ins Reich der Legenden verbannen. Klar ist schon jetzt, dass auf die winterfesten Meereskundler noch eine Menge Arbeit wartet.
Auch in der Antarktis haben ähnliche Untersuchungen bereits gezeigt, dass dort ebenfalls während der Polarnacht deutlich mehr Aktivität unterm Eis herrscht als bislang angenommen.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Frage, wie marine Organismen auf Verunreinigung des Meerwassers etwa mit Öl in geringer Konzentration reagieren oder auf Klimaänderung, die das Eis in Fläche, Dicke und zeitlicher Ausbreitung schrumpfen und das Wasser wärmer werden lässt. Diese und weitere Fragen sollen nun Laboruntersuchungen an lebend gefangenen Fisch- und Planktonarten zeigen.
Die Arbeit auf der Helmer Hanssen wird von norwegischen Wissenschaftlern koordiniert, beteiligt sind aber Forscher aus einer Reihe von Ländern. Auf die Ergebnisse sind Marinbiologen und Klimaforscher aus aller Welt gespannt.
Schon bei Tageslicht geheimnisvoll genug: arktisches Plankton..
Quelle: Svalbardposten
Russisches Atom-U-Boot Krasnodar bei Murmansk in Brand
Das russische Atom-U-Boot Krasnodar, das zur Verschrottung in der Marinewerft Nerpa liegt, steht seit Montag früh in Brand. Das Boot der Oscar II Klasse wurde 2012 als eines der letzten U-Boote aus der Zeit des Kalten Krieges außer Betrieb genommen. Die Krasnodar ist der im August 2000 gesunkenen Kursk sehr ähnlich.
Laut der Webseite BarentsObersver wird beim Verschrotten eines Atom-U-Bootes zuerst der verbrauchte Kernbrennstoff entfernt. Danach folgt die Entfernung der Gummiummantelung des Rumpfes. Bei diesem feuergefährlichen Vorgang ist es schon mehrfach zu Bränden gekommen. Auch beim vorliegenden Brand der Krasnodar scheint es sich um ein Feuer der Gummi-Hülle zu handeln.
Der Abbau der beiden Reaktoren zur Endlagerung an Land erfolgt erst ganz am Ende der Verschrottung. Mit anderen Worten: an Bord des brennenden U-Bootes befinden sich noch zwei Atomreaktoren und somit eine Menge radioaktives Material.
Die Krasnodar liegt nur etwa 100 km von der norwegischen Grenze entfernt. Trotz eines entsprechenden Abkommens zum Austausch von Informationen erfuhren norwegische Behörden erst aus den Medien von dem Brand. Von norwegischer Seite aus wurde der Brand eines Atom-U-Bootes mit Reaktoren an Bord als ernsthafter Vorfall bezeichnet.
Nach russischen Angaben ist bislang keine Radioaktivität entwichen.
Das brennende Atom-U-Boot Krasnodar in der Nerpa Marinewerft bei Murmansk. Foto: b-port.com.
Quelle: Barentsobserver
Motorschlittensaison in Spitzbergen
In Spitzbergen ist die Motorschlittensaison seit einigen Wochen im Gang. Einige Einwohner schwingen sich bereits in der Polarnacht auf die Scooter, aber die meisten Lokalmatadore wie Touristen starten mit Rückkehr des Lichts um Mitte Februar.
So schön die motorisierten Exkursionen in den arktischen Winter sicher sein können, sind sie dennoch nicht ganz ungefährlich. Insbesondere Leute, die weder Erfahrungen mit Motorschlittenfahren noch Ortskenntnis mitbringen, sollten sich geführten Touren anschließen, so die offizielle Empfehlung der Verwaltung, die hier unterstützt wird.
Mehrere Vorfälle der letzten Wochen belegen dies:
- Anfang März mussten in zwei Fällen nach Stürzen mit dem Motorschlitten Touristen mit Knochenbrüchen nach Longyearbyen geholt werden. Ein Sturz ereignete sich in der Moräne des Rabotbreen, der andere im Brattlidalen; beide im Bereich Sassendalen. Beide Touristen waren mit geführten Gruppen unterwegs.
- Am Dienstag (18.3.) musste ein Mann mit Verletzungen im Brustbereich vom Hubschrauber geholt werden. Der Mann war mit einer privaten Touristengruppe unterwegs, über einen Steilhang hinausgefahren und einen 6 Meter hohen Abhang hinabgestürzt. Die Gruppe rief mit dem Mobiltelefon Hilfe, konnte aber keine genaue Position angeben, da weder Ortskenntnis noch GPS vorhanden waren. Die Strecke (entlang der Küste von der Colesbukta nach Barentsburg) wird viel befahren, aber mehrere tiefe Einschnitte stellen Fahranfänger vor Herausforderungen. Wenn man sie nicht kennt und mit überhöhter Geschwindigkeit fährt, sind überraschende Hindernisse dieser Art im Gelände lebensgefährlich.
Darüber hinaus fiel im Grønfjord ein Tourist bei langsamer Fahrt bewusstlos vom Motorschlitten. Weitere Details wurden nicht veröffentlicht, aber die Umstände deuten auf einen Herzinfarkt oder einen ähnlichen medizinischen Notfall.
Die ersten beiden Fälle wie auch andere zeigen, dass es natürlich auch im Rahmen geführter Touren Unfälle gibt. Immerhin sorgen da aber Guides dafür, dass die Geschwindigkeit auch bei vorher nicht sichtbaren Hindernissen dem Gelände angepasst wird, was äußerst wichtig für die Sicherheit beim Fahren ist. Zudem haben geführte Gruppen immer Notfallausrüstung einschließlich Satellitentelefon dabei. Mit dem Handy kann nicht gerechnet werden, da das Mobilfunknetz in Spitzbergen außerhalb der Ortschaften sehr löchrig ist.
Für sichere Touren mit Motorschlitten oder Ski werden empfohlen bzw. sollten bedacht werden:
- Lawinenausrüstung (Schaufel, Lawinensonde und -stange), wenn die Route nicht durch bekanntermaßen lawinensicheres Gelände führt.
- Eigene Ortskenntnis oder ausführliche Beratung durch Leute, die das Gelände kennen. GPS mit Karte, Reservebatterien, zusätzlich Papierkarte und Kompass.
- Notfallausrüstung. Darunter von lokalen Netzen unabhängige Kommunikationsausrüstung: Satellitentelefon, PLB. Zelt, Schlafsack, Isomatte, Kocher, Lebensmittel. Warme Kleidung in Reserve. Man muss damit rechnen, dass die Tour wegen Schlechtwetter oder Motorschlittenpanne plötzlich viel länger dauert als geplant.
- Waffe etc. für Eisbärensicherheit.
- Wenn Erfahrung mit Motorschlitten nicht vorhanden ist: Einweisung durch erfahrenen Fahrer. Motorschlitten-Anfänger sollten nicht alleine ins Gelände.
- Wichtige Reparaturen (z.B. Wechseln des Keilriemens) sollten beherrscht werden.
- Motorschlitten bleiben gerne mal stehen. Wer hierfür nicht ausgerüstet ist, kommt schnell in große Schwierigkeiten, wenn dies weit weg vom Ort passiert.
- Wenn keine Lokalkenntnis vorhanden ist: Die Geschwindigkeit auch im scheinbar ebenen Gelände unerwarteten Geländehindernissen anpassen.
- Helm- und Führerscheinpflicht, Promillegrenzen sowie in weiten Gebieten Anmelde- und Versicherungspflicht sowie motorschlittenfreie Gebiete sind zu beachten. Wer die Regeln und Grenzen nicht kennt, muss sich Ortskundigen bzw. einer geführten Gruppe anschließen.
Die Liste ist nicht komplett, beinhaltet aber wichtige Punkte.
Miet-Motorschlitten, startklar in Longyearbyen.
Quelle: Sysselmannen, Svalbardposten, der eigene Kopf.
Bekommt Longyearbyen die nördlichste Brauerei der Welt?
Auf Spitzbergen sind der Verkauf und die Produktion alkoholischer Getränke bislang strenger geregelt, als im übrigen Norwegen. Außerhalb der Gastronomie wird Alkohol nur vom staatlichen Monopolhandel „Nordpolet“ im Svalbardbutikken in Longyearbyen verkauft und dort sind die erlaubten Mengen für jeden Einzelnen begrenzt. Einwohner legen eine Karte vor und Touristen ihr Flugticket, die gekaufte Menge wird jeweils darauf vermerkt. Die Verarbeitung von Alkohol und damit die Herstellung alkoholischer Getränke ist sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich verboten.
Diese noch aus frühen Bergbausiedlungszeiten stammenden Regelungen sind derzeit auf dem Prüfstand und es sieht sehr danach aus, dass sie bald der Vergangenheit angehören. Bereits vor vier Jahren hatte Robert Johansen aus Longyearbyen beim norwegischen Gesundheitsministerium die Zulassung für einen Brauereibetrieb in Longyearbyen beantragt. Dies war nach geltender Gesetzeslage nicht möglich, aber der politische Betrieb in Oslo zeigte sich zur Abwechslung einmal wohlgesonnen (immerhin geht es um Bier!) und hat den Prozess für eine entsprechende Gesetzesänderung in Gang gesetzt.
Derzeit wird über die Aufhebung der zum Teil aus dem Jahr 1929 stammenden Regelungen entschieden. Aus dem Gesundheits- und dem Landwirtschaftsministerium wurde bereits signalisiert, dass die Änderung der geltenden Regelungen erwünscht ist und dass dieser auch keine Gründe entgegenstehen. Sollte die Gesetzesänderung kommen, würde in einem ersten Schritt die Verarbeitung von Alkohol zugelassen werden. Später könnte dann auch die Mengenbegrenzung beim Alkoholverkauf wegfallen.
Wenn alles seinen erwarteten Gang geht, will Robert Johansen bereits im Sommer 2014 Bier „made in Longyearbyen“ anbieten. Seine Brauerei soll Svalbard Bryggeri AS heißen und zunächst ca. 100.000 Liter im Jahr produzieren. Der Verkauf von passenden Souvenirs ist ebenfalls geplant. Auch in Barentsburg wird auf die mögliche Gesetzesänderung reagiert. Dort hat die russische Bergbaugesellschaft Trust Arktikugol bereits seit 2013 eine kleine Brauerei und sieht jetzt die Möglichkeit zur Ausweitung des Geschäfts.
Sollte in Longyearbyen wirklich Bier gebraut werden, wäre die Svalbard Bryggeri wohl die nördlichste Brauerei der Welt. Bislang beansprucht die Mack Brauerei in Tromsø diesen Titel und sie würde ihn offiziell auch behalten, denn bei dem in Longyearbyen geplanten Jahresvolumen von zunächst 100.000 Liter Bier pro Jahr wäre die Svalbard Bryggeri nach norwegischem Recht eine sog. Mikrobrauerei. Diese Bezeichnung gilt für kleine Brauereien mit einem Jahresvolumen unter 600.000 Litern. Davon sind in Norwegen nördlich von Tromsø zur Zeit einige geplant, z.B. in Hammerfest und in der Gamvik Kommune.
Die Mack Brauerei sieht der Konkurrenz positiv entgegen, verortet sich aber als große Brauerei in einer anderen Kategorie. Seit einigen Jahren braut die Mack Brauerei ihr Bier aus Kostengründen nicht mehr in Tromsø, sondern im südlicher gelegenen Nordkjosbotn. Dass sie weiterhin den Titel „nördlichste Brauerei der Welt“ führen kann, liegt daran, dass sie ihren Firmensitz weiterhin in Tromsø hat.
Bier made in Longyearbyen? Nachfrage gäbe es sicherlich! Nicht nur beim Oktoberfest.
Quelle: Svalbardposten
Arktisches Treibeis: Februar-Ausdehnung sehr gering
Im März erreicht das Treibeis im Jahresverlauf seine maximale Ausdehnung. Dieses Jahr bleibt es allerdings weit hinter der üblichen Fläche zurück: Im Februar-Monatsmittel für die Fläche wurden nur 14,4 Millionen Quadratkilometer beobachtet, 910.000 Quadratkilometer weniger als im Mittel von 1981 bis 2010. Damit belegt der Februar 2014 den vierten Platz der Negativ-Statistik seit 1979, dem Beginn der systematischen Messungen.
Den absoluten Negativrekord hält bislang der Februar 2005.
Immerhin ist die Eisfläche im Februar mit 14.900 Quadratkilometern pro Tag gewachsen. Im langfristigen Mittel liegt die tägliche Zuwachsrate der Fläche allerdings bei 20.300 Quadratkilometern. Schwankungen der Eisfläche im Februar gegen diesen Wachstumstrend, wie scheinbares Schrumpfen, sind nicht durch Schmelzen, sondern durch Eisbewegung und somit Auseinanderziehen und Zusammenschieben der beweglichen Treibeisflächen zu erklären.
Normalerweise erreicht die Fläche des arktischen Treibeises um Mitte März ihre maximale Ausdehnung.
Die Temperaturen im vergangenen Februar lagen in weiten Teilen der Arktis 4 bis 8 Grad über dem langfristigen Monatsmittel.
Treibeis in der Arktis: ausgeprägter Minimalstand im Februar.
Quelle: Snow and Ice Data Centre
Ölpest in Polargebieten: ist und bleibt katastrophal
Fast 25 Jahre ist es her, dass die Exxon Valdez vor Alaska aufgelaufen ist. Am 24. März 1989 erlangte der Öltanker traurige Berühmtheit, als er wegen Navigationsfehlern auf Felsen lief und etwa 37.000 Tonnen Rohöl sich über 2.000 Kilometern Küstenlinie verteilten. Wesentlich zum Unfall beigetragen haben ein alkoholkranker Kapitän und ein überforderter dritter Offizier auf der Brücke. Die Folge war und ist eine ökologische und wirtschaftliche Katastrophe für die ganze Region.
25 Jahr lang hat man somit nun Gelegenheit gehabt, die Folgen einer Ölpest in kalten (aber nicht hocharktischen) Gewässern zu studieren. Die Ergebnisse sind ernüchternd:
- Ein „cleanup“ einer Ölpest mit Roh- oder Schweröl ist praktisch unmöglich. Trotz Einsatz gewaltiger Ressourcen (ca. 2 Milliarden US-$) durch Exxon wurden gerade einmal 7 % des ökologischen Schadens behoben. Bei der Deepwater Horizon Katastrophe im Golf von Mexiko sind es trotz aufgebrachter Mittel von 20 Milliarden US-$ durch BP gerade einmal 3 % Meeresoberfläche und Küsten, die „gereinigt“ wurden, wobei erhebliche Schäden durch Chemikalien angerichtet wurden. Fazit: Es ist unmöglich, die Schäden einer Ölpest durch Roh- oder Schweröl im Nachhinein zu beseitigen.
- Die angerichteten Schäden sind langfristig oder sogar permanent. In Alaska wurden 32 Habitate/Populationen beobachtet, die von der Exxon Valdez Katastrophe betroffen waren. Davon gelten nur 13 als teilweise oder ganz wieder hergestellt. Tausende Tonnen Rohöl sind weiterhin im Sediment gespeichert und vergiften langfristig ihre Umgebung.
- Ökologische Schäden können nicht vom Menschen, sondern nur von der Natur selbst „repariert“ werden – wenn man sie lässt. Damit dies möglich ist, müssen Küsten und Gewässer möglichst ökologisch intakt sein.
- Die Risiken, also der Umfang von Schäden einer Ölpest und ihre Eintrittswahrscheinlichkeit, werden durch Behörden und Industrie regelmäßig unterschätzt oder heruntergespielt.
- Die einzig sinnvolle Strategie ist Vorbeugung. Aktuell neigt die Industrie allerdings zu Vorsichtsmaßnahmen mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis, nicht aber zu den bestmöglichen Vorsichtsmaßnahmen, die technisch verfügbar wären.
- In kalten Regionen steigt der Grad, in dem die Probleme unbeherrschbar sind. Ist eine Ölpest bereits in warmen Gegenden unkontrollierbar, so ist ihre Eingrenzung in Eisregionen der Hocharktis jenseits jeglicher Realität.
Dies sind einige der Kernthesen, zu denen Professor Richard Steiner in einem Beitrag in der Huffington Post kommt. Langfristig bietet laut Steiner nur der Verzicht auf Förderung und Transport von Öl Schutz vor massiven Ölunfällen. Diese Forderung wurde bereits nach der Katastrophe der Exxon Valdez im März 1989 laut, von der Umsetzung ist man, global gesehen, aber weiter entfernt als je zuvor.
Mini-Ölpest bei einer Antarktis-Station bei einem undichten Dieseltank.
Quelle: Huffington Post
Rentier bei Autounfall in Longyearbyen umgekommen
Montag Abend kam es im sonst an Verkehrsunfällen armen Longyearbyen zu einem traurigen Unfall: Auf der Straße 500 wurde ein Rentier von einem Auto angefahren. Dem Tier wurde dabei der Rücken gebrochen, so dass der Polizei nichts anderes als der Gnadenschuss übrig blieb. Fast immer sind ein paar Rentiere innerhalb von Longyearbyen unterwegs, die keine Scheu vor Menschen und Fahrzeugen zeigen und immer wieder ohne zu schauen über die Straße stiefeln. Entsprechend vorsichtig muss man dort fahren und dabei die Augen offen halten, insbesondere zu Zeiten mit nächtlicher Dunkelheit.
Vei 500 ist die „Hauptstraße“ zwischen Zentrum und Fluss. In Longyearbyen haben die meisten Straßen keine Namen, sondern nur Nummern.
Rentier neben der Straße in Longyearbyen.
Quelle: Sysselmannen
Arktis-Reisen: Spitzbergen, Jan Mayen, Ostgrönland 2014, 2015
Mitteilung in eigener Sache – Arktis-Reisen 2014 und 2015
Die Arktis-Reisen 2014 sind schon eine ganze Weile weitgehend ausgebucht. Wer aber dieses Jahr noch mit uns auf der SV Antigua nach Spitzbergen will, hat im September noch die Möglichkeit: Schwerpunkte Naturkunde, Fotografie, Wandern (hier klicken für mehr Informationen).
Nun stehen auch die Termine für die Arktis-Fahrten 2015 fest. Detaillierte Informationen werden noch folgen, aber da die Fahrten erfahrungsgemäß früh ausgebucht sein werden (etliche Plätze sind bereits jetzt belegt), lohnt es sich bei Interesse, frühzeitig unverbindlich anzufragen (Kontakt).
Wir planen im Einzelnen 2015 folgende Spitzbergen-Reisen:
- Rund um Spitzbergen mit der Antigua, 30. Juni-17. Juli 2015.
- Spitzbergen für Fortgeschrittene: Expedition mit der Arctica II, 19. Juli-06. August 2015.
- West- und Nordspitzbergen mit der Antigua, Schwerpunkt Gletschertouren: 15.-25. September 2015. Vergleiche unsere schöne Gletscherfahrt von 2012!
Die Expeditionen nach Jan Mayen sind übrigens bislang ausgebucht, bevor wir sie überhaupt richtig anbieten können. 2014 war schneller voll, als man hinschauen konnte; ähnlich war es bei der Fahrt nach Jan Mayen 2015. Wer also potenziell Interesse hat, 2016 nach Jan Mayen zu kommen, sollte wirklich frühzeitig Kontakt aufnehmen.
Wir planen, auch 2015 wieder den Scoresbysund in Ostgrönland mit der SV Ópal anzulaufen (siehe die entsprechenden Fotos und Reiseberichte von 2013: Fahrt 1 und Fahrt 2). Diesbezüglich ist die Planung aktuell noch in einem eher frühen Stadium, aber dennoch sollte unverbindlich Kontakt aufnehmen, wer potenziell gerne mitkommen würde.
Arktis unter Segeln: Spitzbergen, Jan Mayen, Ostgrönland 2015.
Februar schlägt Wetterrekorde in Spitzbergen
Der Februar hat in Spitzbergen Temperaturrekorde geschlagen: Wochenlang haben die Temperaturen um den Gefrierpunkt gelegen, teilweise sogar darüber. Nur die ersten 10 Tage bewegten sich mit Temperaturen unterhalb von -10°C im normalen Bereich, danach verdrängten temperierte atlantische Luftmassen die kältere Polarluft.
Als Monatsdurchschnitt haben die Meteorologen den Wert von -1,2°C angegeben, also nicht weniger als 15 Grad über der langjährigen Durchschnittstemperatur für den Februar von -16,2°C.
Man kann vermuten, dass sich mit den warmen Luftmassen auch relativ warmes Wasser um Spitzbergen herum befindet. Dies liegt jedenfalls der Blick auf die Eiskarte nahe. Große Teile der Gewässer nördlich und östlich von Spitzbergen sind aktuell mehr oder weniger offen. Selbst innere Fjordarme wie Tempelfjord und Billefjord im inneren Isfjord scheinen dieses Jahr nicht zufrieren zu wollen.
Die aktuelle Vorhersage weist immerhin keine Plusgrade auf, und während es in Longyearbyen nicht weit unter Null Grad ist, sollen die Temperaturen an der Ostküste am Wochenende bei bis zu -30°C gelegen haben.
Auch in weiten Teilen des norwegischen Festlands verläuft der Winter bislang viel wärmer als normal.
Sogar der kleine Adventfjord ist wegen milder Wassermassen schon seit mehreren Jahren nicht mehr richtig zugefroren.
Quelle: NRK
Neues Kohlebergwerk am Lunckefjellet offiziell eröffnet
Am Dienstag (25.2.) hat die Bergbaugesellschaft Store Norske ihr neues Kohlebergwerk am Lunckefjellet, zwischen Sveagruva und dem Reindalen, offiziell mit einer kleinen Feier vor Ort eröffnet. Neben Belegschaft und Betriebsführung waren das norwegische Fernsehen und die Gemeindeverwaltung aus Longyearbyen präsent. Bergarbeiter Terje Nylund durchschnitt das Band; er war hierzu durch Losverfahren bestimmt worden, anstatt dass Firmenprominenz sich diese Symbolhandlung sichert, wie es sonst so oft ist, eine schöne Geste seitens der SNSK-Führung.
Tatsächlich verließ die erste Tonne Kohle bereits am 25. Oktober das Lunckefjellet, dies geschah aber noch im Rahmen vorbereitender Arbeiten, die nun aber bald abgeschlossen sein sollen. Dann soll alles zur Produktion von etwa 10.000 Tonnen pro Tag bereit sein. Die letzte Eröffnung eines neuen Bergwerkes auf Spitzbergen war vor 14 Jahren.
Wirtschaftlich hat die Store Norske derzeit weniger Grund zur Freude. Der Weltmarktpreis steht unter Druck, das Wechselkursrisiko ist hoch. Ein Verfall des Dollarkurses von gut 1% kann den Konzern im Ergebnis 1,2 Millionen Euro kosten. Seit mehreren Jahren schreibt der Betrieb rote Zahlen, was sich auch 2014 wohl trotz leichter Entspannung nicht ändern wird. Zu den Kosten für die Eröffnung des neuen Bergwerks kommen Verluste im Betrieb von Svea Nord, wo der Abbau in marginale Bereiche mit abnehmender Qualität und Quantität kommt.
Für 2013 gibt Store Norske folgende Zahlen an:
• Produktion: 1.855.000 Tonnen Kohle (2012: 1.229.000)
• 1,32 Milliarden Kronen (ca. 160 Millionen Euro) Einnahmen
• Verkauf: 2.135.000 Tonnen Kohle (2012: 701.000 Tonnen)
Die Wirtschaftlichkeit der neuen Grube über ihre geplante Lebensdauer von 6-7 Jahren bezeichnet die Store Norske bereits unter gegebenen Bedingungen (Kohlepreis) als marginal. Der Konzern investiert in Forschung, die zusätzliche oder höhere Einnahmen erbringen soll, wie die Veredlung der Kohle oder Verwendung für höherwertige Zwecke als Energiegewinnung. Längerfristig hofft man auf neue Gruben in der Nähe von Sveagruva (Ispallen) und Longyearbyen (Operafjellet).
Auch politisch ist die Zukunft des Kohlebergbaus in Spitzbergen ungewiss. In Longyearbyen weiß man aber genau, dass viele Arbeitsplätze und bei aktueller Wirtschaftsstruktur der Wohlstand und eine tragfähige Bevölkerung vor Ort nach wie vor stark vom Bergbau abhängig sind.
Kohleführende Schichten am Lunckefjellet. Foto: Malte Jochmann, SNSK.
Quelle: SNSK Bedriftsnytt, Svalbardposten (09/2014)
Russland weitet militärische Präsenz in der Arktis aus
2014 will Russland seine militärische Präsenz in der Arktis erweitern und dazu ein neues Kommando einrichten, das die nationalen Interessen in der Arktis verteidigen soll. Dies beinhaltet sowohl den Schutz militärischer Einrichtungen und ziviler Schiffe als auch die Absicherung des Zugangs zu den natürlichen Ressourcen in der Region.
Die neu etablierte Struktur trägt den Namen „Northern Fleet – United Strategic Command“ (SF-OSK), sie soll den Status eines Militärbezirks haben, auch wenn sie offiziell nicht so genannt wird. Bislang ist das russische Militär in vier großen Bezirken organisiert: West, Süd, Zentral und Ost.
Hauptbestandteil des SF-OSK wird die russische Nordflotte sein, die in der Region um Murmansk, nahe der norwegischen Grenze stationiert ist. Sie soll aus dem „Westlichen Militärbezirk“ ausgegliedert und in das neue SF-OSK integriert werden, ebenso wie weitere Einheiten aus dem Norden Russlands. Neue Streitkräfte sollen auf Novaya Semlya, den Neusibirischen Inseln und Franz-Josef Land stationiert werden.
Die strategische Neuausrichtung des russischen Militärs muss auch vor dem Hintergrund der jüngeren Rohstoffexplorationen in der Arktis gesehen werden. Auf dem arktischen Schelf werden 30% der weltweit unentdeckten Gas- und 15% der Ölvorkommen vermutet. Ebenso wie andere Länder in der Region verteidigt Russland hier seine ökonomischen Interessen, die russische Regierung macht daraus kein Geheimnis. Vorschlägen, die Arktis, ähnlich wie die Antarktis, unter internationale Kontrolle zu stellen beziehungsweise dort überregionale Schutzgebiete einzurichten, erteilte der russische Präsident Vladimir Putin noch im Oktober letzten Jahres eine klare Absage.
Bukhta Tikhaya, eine bereits 1959 aufgegebene Station auf Hooker Island (Ostrov Gukera), Franz Josef Land. 2014 wird Russland in der Arktis wieder stärker präsent sein.
Quelle: Barentsnova
Rückgang des arktischen Meereises beschleunigt die Erderwärmung
Der Rückgang des arktischen Meereises gilt als ein Beschleuniger des Klimawandels, denn die hellen Eisflächen reflektieren das Sonnenlicht stärker als die vergleichsweise dunklen Wasserflächen. Das Eis kann bis zu 90% der Sonnenenergie ins All zurückstrahlen, während Wasser einen großen Teil der Energie aufnimmt und sich und die darüber liegende Luft erwärmt.
Führt nun eine durch andere Effekte hervorgerufene Erwärmung zum Abschmelzen des Eises, so bewirkt dies wiederum eine weitere Erwärmung und das Eis schmilzt noch schneller. Die Effekte verstärken sich gegenseitig, man spricht von positiver Rückkopplung. Umgekehrt funktioniert dies natürlich genauso: Würde sich durch niedrigere Temperaturen die mit Schnee und Eis bedeckte Fläche ausdehnen, würde dies eine weitere Abkühlung bewirken.
Die Fähigkeit von Oberflächen, Strahlung zu reflektieren, wird durch die Albedo ausgedrückt, eine Zahl, die den Anteil der reflektierten Strahlung in Prozent angibt.
Forscher der University of California in San Diego konnten nun mithilfe von Satellitenmessungen bestätigen, dass die Albedo nördlich des 60. Breitengrades sinkt und dass dies mit dem Rückgang des Meereises in Zusammenhang steht. Die Messungen ergaben ein Absinken der Albedo von 0,52 auf 0,48 in den Jahren zwischen 1979 und 2011. Statt 52% werden also mittlerweile nur noch 48% der Sonnenstrahlung in der Arktis reflektiert. Dies entspricht einer zusätzlich absorbierten Sonnenenergie von durchschnittlich ca. 6,4 Watt pro Quadratmeter (W/m²) seit 1979. Hochgerechnet auf die gesamte Erdoberfläche ergibt dies eine zusätzliche Energieaufnahme von 0,21 W/m², ein Viertel des Wertes, der dem CO2 Anstieg im selben Zeitraum (0,8 W/m²) zugerechnet wird.
Die gemessenen Werte liegen damit deutlich über denen, die bisher durch Schätzungen und Modellrechnungen angenommen wurden.
Ein weiteres Ergebnis der Messungen ist, dass die Albedo auch auf solchen Flächen gesunken ist, die ganzjährig von Meereis bedeckt sind. Eine Erklärung hierfür ist die zunehmende Bildung von Schmelzwasserflächen auf dem Eis, die ihrerseits mehr Sonnenenergie aufnehmen und eine entsprechende Erwärmung bewirken.
Schmelzendes Fjordeis im Liefdefjord.
Quellen: Spiegel Online Wissenschaft, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)
Polarnacht, Polartag
Am Donnerstag (20. Februar) wird in Barentsburg die Rückkehr der Sonne gefeiert, die sich zum ersten Mal seit Ende Oktober wieder über den Bergen zeigt. In Longyearbyen muss noch bis zum 08. März gewartet werden, da der Blick nach Süden deutlich stärker von Bergen verstellt ist.
Eine passende Gelegenheit für ein paar Informationen zu Polarnacht und Polartag. Die grundlegende Himmelsmechanik mit der Neigung der Erdachse, die zur Entstehung von Polartag und Polarnacht führt, ist sicher allgemein bekannt. Wahrscheinlich auch, dass durch Brechung des Lichts in der Atmosphäre der Polartag immer etwas länger ist als die Polarnacht: Die Sonne ist oft über dem Horizont sichtbar, wenn sie tatsächlich direkt unter dem Horizont steht. Die Stärke dieses Effekts variiert je nach Wetterlage. Nach einer frühen Beschreibung des Effekts bei der Überwinterung von Barents auf Novaya Zemlya (1596-76, die Reise, auf der auch Spitzbergen entdeckt wurde) wird dieses Phänomen auch als Novaya-Zemlya-Effekt bezeichnet.
Soweit so gut. Dennoch sollte die Polarnacht in Arktis und Antarktis zwar um ein halbes Jahr versetzt im Winter der jeweiligen Halbkugel, aber dennoch auf gleicher Breitenlage gleich lang sein. Denkt man. Ist aber nicht so. In der South Polar Times, Ausgabe 1 vom April 1902 (Expeditionszeitung von Scotts erster Antarktis-Reise mit der Discovery, Herausgeber: Ernest Shackleton, erschienen auf der Discovery im McMurdo Sound) steht das so (übersetzt): Der Südpolarwinter ist fast acht Tage länger als der Nordpolarwinter. Dies ist so, da sich die Erde im ersten Fall weiter weg von der Sonne befindet (Aphelion), und sich daher langsamer auf ihrer Umlaufbahn bewegt. Im Nordwinter ist die Erde näher an der Sonne (Perihelion), und bewegt sich daher schneller.“
Der Grund ist das 2. Keplersche Gesetzt, das besagt: Ein von der Sonne zum Planeten gezogener „Fahrstrahl“ überstreicht in gleichen Zeiten gleich große Flächen. (Zitat aus Wikipedia). Somit bewegt sich die Erde schneller auf ihrer Umlaufbahn, wenn sie näher an der Sonne ist. Das ist im Winter der Nordhalbkugel der Fall. Logo, oder?
Somit verbringt die Erde weniger Zeit in dem Teil der Umlaufbahn, der der Arktis die Polarnacht beschert. Im Südwinter hingegen ist sie langsamer und verbringt daher mehr Zeit in der Position, welche der Antarktis die Polarnacht bringt.
Wie groß ist der Effekt? Die Länge der Polarnacht beträgt
auf 80°Nord: 122 Tage (21 Oktober – 20. Februar)
auf 80°Süd: 128 Tage (18. April – 24. August)
Der Unterschied beträgt also immerhin sechs Tage! Die Werte lassen sich auf der Seite des US Naval Observatory berechnen.
Hut Point, wo die South Polar Times 1902 erstmalig erschien, liegt auf 77°47’S, also 133 Meilen nördlich des 80. Breitengrades. Somit sind die dort angegebenen acht Tage Unterschied etwas übertrieben, aber auf den Pol selbst trifft das beinahe zu.
Polarnacht in Nord und Süd auf gleicher Breite sind somit nicht gleich lang.
Für fachliche Information und den Hinweis auf das US Naval Observatory danke ich Andreas Kaufer.
Das letzte Sonnenlicht direkt vor Beginn der Polarnacht in Barentsburg, 22. Oktober.
Noorderlicht wartet auf ihren Einsatz im Tempelfjord
Wie in den vergangenen Jahren, soll sich auch in diesem Jahr der Zweimaster Noorderlicht im Eis des Tempelfjord einfrieren lassen und dort während der Wintersaison als Ausflugsziel für Hunde- und Motorschlittentouren dienen. Leider fehlt bislang das Eis und so wartet das Schiff noch auf seinen Einsatz. Ähnlich wie im letzten Jahr drücken südliche Winde viel warmes Wasser in den Isfjord, an dessen östlichem Ende der Tempelfjord liegt. Dazu kommen ungewöhnlich hohe Temperaturen, die seit Wochen um den Gefrierpunkt liegen und Spitzbergen einen der wärmsten Winter seit Beginn der Aufzeichnungen bescheren. Die Reiseveranstalter hoffen nun auf niedrigere Temperaturen, sodass die Saison Ende Februar, wenn die ersten Touristen kommen, wie geplant starten kann. Im letzten Jahr war es ab März kälter und das „Boot im Eis“ konnte seinen Dienst rechtzeitig aufnehmen.
Noorderlicht im Tempelfjord, April 2013.
Quelle: Svalbardposten
Einwohnerzahl in Longyearbyen schrumpft
Gegen einen jahrelangen Trend ist die Einwohnerzahl in Longyearbyen im letzten Jahr um 47 auf 2043 zurück gegangen. Dies geht aus dem Jahresbericht des Sysselmannen für das Jahr 2013 hervor. Wie die Svalbardposten berichtet, sind unter den 47 allein 17 Kinder im Vorschulalter, immerhin 36%.
Im Vergleich zu ähnlich großen Orten auf dem norwegischen Festland kann die Einwohnerzahl in Longyearbyen relativ stark variieren, denn wer in Longyearbyen als Einwohner registriert ist, lebt dort üblicher Weise für eine begrenzte Zeit, meistens im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit. Die Arbeitsverträge sind befristet, Wechsel unter den Mitarbeitern sind häufig erwünscht und viele zieht es nach einer Saison wieder zurück aufs Festland. Mit einer hohen Fluktuation muss also gerechnet werden.
In den letzten Jahren war die Einwohnerzahl jedoch stetig gestiegen, im Jahr 2010 lag sie bei 1966, in 2011 bei 2063 und in 2012 bei 2090. So wird die Nachricht über den Bevölkerungsrückgang von Seiten der Lokalverwaltung auch mit Gelassenheit aufgenommen, von einem negativen Langzeittrend wird nicht ausgegangen.
In Svalbardposten wird über mögliche Gründe für die aktuell niedrigere Einwohnerzahl spekuliert: Es werden Umstrukturierungen bei der Bergbaugesellschaft Store Norske genannt, die zu Personalabbau geführt hatten. Außerdem lässt der relativ hohe Rückgang bei Kindern im Vorschulalter darauf schließen, dass überdurchschnittlich viele Personen ohne Familie zugezogen sind. Da der Stichtag für die Bestimmung der Einwohnerzahl jeweils der 31.12. jeden Jahres ist, kann zudem damit gerechnet werden, dass sich die Abweichung im Laufe des Jahres wieder relativiert.
Der Sysselmannen veröffentlicht in seinem Jahresbericht die Einwohnerzahlen für ganz Spitzbergen, also nicht nur für Longyearbyen, sondern auch für die Siedlungen Ny Ålesund (34) und Barentsburg (419), den Hotelbetrieb auf Kapp Linné (Isfjord Radio) (1), die vier Trapperstationen Kapp Wijk (1), Akseløya (1), Kapp Schollin (1) und Farmhamna (1) und für die polnische Polarstation am Hornsund (10). Die Beschäftigten im Kohlebergbau in Sveagruva, Svea Nord und Lunckefjell gelten als Pendler und haben ihren Wohnsitz in Longyearbyen oder auf dem Festland. Durchschnittlich waren dort im letzten Jahr 208 Personen beschäftigt.
Hat derzeit ein paar Schüler weniger als sonst: Die Schule in Longyearbyen.
News-Auflistung generiert am 09. Mai 2025 um 18:55:08 Uhr (GMT+1)