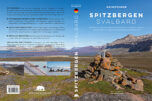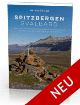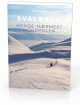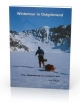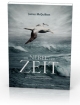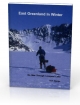-
aktuelle
Empfehlungen- Spitzbergen unter Segeln 2025
Kurs Arktis im Sommer 2025
- Spitzbergen-Reiseführer
Aktualisierte Neuauflage 2025
- Spitzbergen unter Segeln 2025
Kurs Arktis im Sommer 2025
Seitenstruktur
-
Nachrichten
- Monat auswählen
- Mai 2025
- April 2025
- März 2025
- Februar 2025
- Januar 2025
- Dezember 2024
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- April 2024
- März 2024
- Februar 2024
- Januar 2024
- Dezember 2023
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- August 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- Februar 2022
- Januar 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- Oktober 2021
- September 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- April 2021
- März 2021
- Februar 2021
- Januar 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- September 2020
- August 2020
- Juli 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- April 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Januar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- Oktober 2019
- September 2019
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- Januar 2019
- Dezember 2018
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- August 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Januar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Juli 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012
- März 2012
- Februar 2012
- Januar 2012
- Dezember 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- August 2011
- Mai 2011
- April 2011
- März 2011
- Februar 2011
- Januar 2011
- Dezember 2010
- November 2010
- September 2010
- August 2010
- Juli 2010
- Juni 2010
- Mai 2010
- April 2010
- März 2010
- Februar 2010
- November 2009
- Oktober 2009
- September 2009
- August 2009
- Juli 2009
- Juni 2009
- Mai 2009
- April 2009
- März 2009
- Februar 2009
- Januar 2009
- Dezember 2008
- November 2008
- Oktober 2008
- August 2008
- Juli 2008
- Juni 2008
- Mai 2008
- April 2008
- März 2008
- Februar 2008
- April 2000
- Monat auswählen
-
Wetterinformationen
-
Newsletter

| Spitzbergen-Reiseführer: Neuauflage ist da 🤩 |
Home →
Jahres-Archiv: 2011 − Nachrichten
Lokalstyre gewählt
Große Spitzbergenpolitik wird in Oslo gemacht und in gewissem Umfang beim Sysselmannen in Longyearbyen, der von der Regierung in Oslo ernannt wird. Longyearbyen Lokalstyre hat eher die Funktion einer Kommunalverwaltung. Bei den Wahlen am 9. und 10. Oktober haben von 1592 Stimmberechtigten immerhin 907 ihre Stimme abgegeben. Von den 5 angetretenen Parteien gewann mit Abstand die Arbeiderpartiet (Sozialisten) mit 43,7 % die meisten Stimmen.
Die politischen Unterschiede zwischen den Parteien in Longyearbyen sind überschaubar. Inhaltlich am stärksten hebt sich die „Konsekvenslista“ ab, deren Hauptforderung die Abschaffung der Lokalstyre ist und deren beiden gewählte Repräsentanten sich als politische „Wachhunde“ verstehen.
Longyearbyen: In 100 Jahren von betriebseigener Werksiedlung hin zur Lokaldemokratie.
Quelle: Longyearbyen Lokalstyre
Ost Svalbard
Die seit 2007 laufende Diskussion um einen neuen Verwaltungsplan für den Osten Svalbards, einschließlich möglicherweise Schließungen größerer Flächen für die Öffentlichkeit, ist wieder einen Schritt weiter. Eine Arbeitsgruppe des Sysselmannen hat einen Vorschlag vorgelegt, in dem zunächst festgestellt wird, dass »derzeitige oder künftige Forschung im Osten Svalbards durch anderweitige Aktivität in diesem Gebiet, so wie sie derzeit stattfindet, nicht negativ beeinflusst wird« (Sysselmannen: Verwaltungsplan für Ost-Svalbard, Teilbericht Forschung und Ausbildung, norwegisch). Eine greifbare Definition für den Begriff »Referenzgebiet« wird nicht vorgelegt, ein Bedarf an solchen Gebieten wird auch von wissenschaftlichen Institutionen nicht festgestellt.
Dennoch wird vorgeschlagen, mehrere größere Teilgebiete des Ostens von Svalbard als »Referenzgebiete« auszuweisen und vollständig zu sperren. Dem aktuellen Vorschlag zufolge sollen nur noch Wissenschaftler mit Arbeiten in »verwaltungsrelevanten Bereichen« Zugang erhalten. Die untenstehende Karte gibt einen Überblick über die vorgeschlagenen Gebiete.
Auf den Ablauf von Expeditionsschiffreisen hätte eine Sperrungen dieser Gebiete nur einen recht geringen Einfluss. Erwartungsgemäß stößt der aktuelle Vorschlag dennoch auf massive Kritik unter Bewohnern und in der Lokalpolitik Longyearbyens, bei lokalen Reiseanbietern und im Wissenschaftsmilieu (UNIS):
- »Es scheint, als würden die Behörden die Leute (durch die lange Dauer des Prozesses) bewusst ermüden wollen. … eine so umfassende Schließung … erscheint absolut unnotwendig. Im Rahmen des existierenden Regelwerks hat der Sysselmannen bereits weitreichende Möglichkeiten, Verkehr in den Naturreservaten im Osten Svalbards zu begrenzen.« So Heinrich Eggenfellner, stellvertretender Vorsitzender der Longyearbyen Lokalstyre (etwa: Gemeinderat) gegenüber der Svalbardposten (39/2011). Eggenfellner geht auch davon aus, dass die Arbeitsgruppe des Sysselmannen stark durch praxisferne Osloer Behörden beeinflusst wird: »auf mich wirkt es so, als ob der gesamte Prozess vom Verwaltungsapparat im Norwegischen Polarinstitut und im Direktorat für Naturverwaltung gesteuert wird. Die sind nicht mit den Forschern auf einer Linie, daher wirkt das alles ziemlich absurd.«
- Kritisiert wird die offensichtlich fehlende fachliche Begründung sowie dass die mitunter eingriffsintensiven Fischereiaktivitäten ausgenommen sind, während Regionen für Tourismus und weite Teile des Forschungsbetriebs geschlossen werden sollen. In dieser Richtung argumentieren etwa Kjell Mork (bis Oktober 2011 Vorsitzender der Longyearbyen Lokalstyre) und Trygve Steen (Direktor von Spitsbergen Travel, dem größten lokalen Reiseveranstalter in Longyearbyen) in der Svalbardposten.
- Laut Gunnar Sand, Direktor der lokalen Universität UNIS, bedroht eine derartige Regelung die „Existenzgrundlage“ von UNIS, die nicht explizit das betreibt, was als „verwaltungsrelevante Forschung“ beschrieben wird, sondern Grundlagenforschung und Ausbildung. Weiterhin stellt Sand die Kompetenz des Sysselmannen infrage, verschiedene Forschungsbereiche nach Relevanz zu unterscheiden.
- Der Betreiber dieser Webseite und Verfasser dieser Zeilen schließt sich dahingehend an, dass Gebiete, zumal größere, nicht gesperrt werden sollen, solange hierfür keine Begründung, etwa aus den Bereichen Umweltschutz oder wissenschaftlicher Bedarf, vorliegt.
Der Vorgang wird weiter intern und politisch diskutiert, mit einer endgültigen Entscheidung ist vermutlich nicht vor Herbst 2012 zu rechnen.
Vorschlag für sogenannte „Referenzgebiete“ im Osten Svalbards.
Karte: Norwegisches Polarinstitut, modifiziert von Svalbardposten.
Quelle: Sysselmannen, Svalbardposten
Passkontrolle am Flughafen Longyearbyen
Viele Touristen wissen nicht, dass Spitzbergen (Svalbard) im Gegensatz zu Norwegen nicht zum Schengen-Vertragsgebiet gehört. Wer also ein Visum braucht, um ins Schengengebiet einzureisen, benötigt zur Reise von Longyearbyen nach Norwegen eigens ein Schengen-Visum, auch auf der Rückreise von einer Urlaubsreise. Wer somit vor der Reise von zuhause aus ein Visum beantragt, sollte gleich 2 Visa beantragen, um für die Rückreise gerüstet zu sein. Notfalls kann auch der Sysselmannen in Longyearbyen Visa ausstellen, dies allerdings nur zu Büro-Öffnungszeiten und mit entsprechender Bearbeitungszeit.
Für Reisende mit Pässen aus Schengen-Mitgliedsstaaten ist natürlich kein Visum erforderlich. Notwendig für die Reise nach oder von Longyearbyen ist hingegen ein Pass oder Personalausweis. Nur norwegische Staatsangehörige können sich auch beispielsweise mit einem Führerschein ausweisen. Nicht-norwegischen Staatsbürgern wurde in Longyearbyen bereits der Zugang zum Flugzeug verwehrt, da sie keinen Pass oder Ausweis bei sich trugen.
Longyearbyen Flughafen, seit Anfang 2011 mit Passkontrolle.
Quelle: Svalbardposten (3611), Sysselmannen
Eisbärenalarmzaun
Beim Zelten in Spitzbergen ist es sinnvoll und üblich, das Zelt gegen Eisbären mit einem Alarmzaun (norwegisch: Snublebluss) zu sichern, an dem Knallkörper mit Auslösermechanismen befestigt sind. Die bislang zuverlässigste Version NM4 stammte aus norwegischen Militärbeständen, ist aber aus rechtlichen Gründen nicht mehr erhältlich und die Bestände bald aufgebraucht. Die Nachfolgeversion (M2) wird als nicht sicher und zuverlässig genug betrachtet. Somit sind derzeit kaum noch Eisbärenalarmzäune in Longyearbyen erhältlich.
Neben der offensichtlichen Sicherheitslücke wird das Problem dadurch verschärft, dass eine gesetzliche Vorschrift zum Sichern von Lagern gegen Eisbärenangriffe mit allen verfügbaren Mitteln in der Diskussion ist; eine Arbeitsgruppe soll klären, was darunter gegebenenfalls zu verstehen sein wird. Dem Sysselmannen ist bewusst, dass vorgeschriebene Ausrüstung auf dem Markt erhältlich sein muss und hat sich vermittelnd eingeschaltet, bislang ist allerdings in Longyearbyen keine Lösung in Sicht.
Bei dem tödlichen Eisbärenangriff vom 05. August des vergangenen Sommers im Tempelfjord trug ein versagendes Alarmsystem zur Katastrophe bei.
In Großbritannien ist von Arctic Limited ein System erhältlich, von dem Spitzbergen.de allerdings noch keine Test- oder Erfahrungsberichte vorliegen.
Eisbärenwarnzaun vom alten Typ (NM4), fast nicht mehr erhältlich.
Quelle: Svalbardposten (3611), Sysselmannen
Tourismus-Kontrolle durch Sysselmannen fast befundfrei
Die Feldinspektoren des Sysselmannen haben während des vergangenen Sommers zu Kontrollzwecken 85 Schiffe und Boote besucht, vorwiegend an der Westküste, aber auch in abgelegeneren Regionen wie der Hinlopenstraße. Kontrolliert wurden u.a. Genehmigungen, Schiffspapiere, Abfallmanagement etc; zusätzlich wird gegenüber allen Besuchern Präsenz gezeigt und zur Beachtung der Gesetze und Umweltschutzregeln aufgefordert. Auch Zeltlager und Forschungsaktivitäten wurden kontrolliert.
Negativ fielen trotz Kontakt mit 2403 Personen während der Kontrollen nur zwei Vorgänge auf: Eine Gruppe hatte in Grumantbyen, das aufgrund seines Alters als Kulturdenkmal geschützt ist, ein Zeltlager eingerichtet. Eine weitere Touristengruppe hatte um ihre Zelte herum kleine Drainagegräben angelegt, die nicht beseitigt wurden; der Veranstalter muss dies nachholen.
Feldinspektoren des Sysselmannen im Magdalenefjord, Juli 2011.
Quelle: Sysselmannen
Tollwut
Innerhalb weniger Tage wurde in Longyearbyens nächster Umgebung mehrfach Tollwut nachgewiesen: Zunächst in Proben von einem Eisfuchs, der einen Hund gebissen hatte. Nun wurde der Erreger auch in zwei Rentieren nachgewiesen, die erschossen wurden, nachdem Lähmungserscheinungen den Verdacht auf die Krankheit aufkommen ließen. Dies ist in Spitzbergen, soweit bekannt, das erste Mal, dass der Tollwuterreger von Eisfüchsen auf andere Arten überspringt. Tollwut ist eine für Menschen tödliche Krankheit. Die Behörden rufen zur Vorsicht auf:
- jegliche Berührung mit lebenden Tieren und Kadavern vermeiden,
- bei dennoch versehentlicher Berührung umgehend gründlich Händewaschen,
- bei Verdachtsfällen bei Mensch oder Tier den Sysselmannen informieren,
- Hunde dürfen derzeit in und bei Longyearbyen nicht frei herumlaufen, angeleinte Hunde im Freien müssen ständig beaufsichtigt werden.
Der Sysselmann wird die Umgebung Longyearbyens in näherer Zukunft regelmäßig auf potenziell erkrankte Tiere kontrollieren und von möglichst vielen Eisfüchsen Proben nehmen.
Dieses Rentier ruht sich einfach nur aus. Nun wurden mit Tollwut infizierte Artgenossen gefunden.
Quelle: Sysselmannen
Tödlicher Eisbärenangriff III
Der Eisbär, dessen Angriff auf das englische Jugendlager im Tempelfjord einen Toten und mehrere Verletzte zur Folge hatte, war ein altes, abgemagertes Tier, das unter starken Zahnschmerzen gelitten haben muss; mehrere Nerven waren durch Beschädigung an den Zähnen teilweise freigelegt. Möglicherweise war der Bär deswegen in seinen Jagdmöglichkeiten eingeschränkt und daher sehr hungrig. Ob ein Eisbär durch Schmerzen aggressiver wird, ist möglich, aber nicht bestätigt.
Sicher ist hingegen, dass im Fall der englischen Gruppe alle technischen Sicherheitssysteme versagten: Der Alarmzaun löste nicht aus, und sowohl die Signalpistole als auch das Gewehr versagten zunächst ihren Dienst. Die Gründe sind bislang noch unbekannt, Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.
Das Thema Alarmzaun wird hinsichtlich Verfügbarkeit und Verlässlichkeit bereits länger diskutiert. Das bislang verlässlichste System ist militärischer Herkunft und in Longyearbyen mietbar, allerdings sind die Vorräte bald aufgebraucht und eine neue Quelle des militärischen Materials konnte bislang nicht erschlossen werden, obwohl der Sysselmannen sich einbringt.
Fraglich ist, warum die gemietete Repetierbüchse vom Typ Mauser zunächst versagt hat. Die Gruppenleiter versuchten viermal, auf den Bären zu schießen, aber keiner der Schüsse löste aus. Möglich ist eine Fehlbedienung der Waffe. Der Sicherungsknopf hat zwischen »gesichert« und »ungesichert« eine dritte Stellung, in der man repetieren, aber nicht schießen kann. Dies dient dem sicheren Entladen mittels Durchrepetieren. In dieser Stellung wäre es möglich, zu repetieren und das Nicht-Lösen der Schüsse in der Panik der versagenden Munition oder Waffe zuzuschreiben. Ob dies im Fall der Gruppe im Tempelfjord passiert ist, ist bislang allerdings spekulativ.
Erst als ein bereits verletzter Gruppenleiter eine der am Boden liegenden Patronen fand und nochmals lud, konnte er den Eisbären mit einem laut Sysselmannen »preisverdächtigen« Schuss töten und so noch größeren Schaden abwenden.
Repetierbüchsen zum Schutz vor Eisbären, mit zwei Mauser-Büchsen (Mitte und Rechts).
Tödlicher Eisbärenangriff II
Der für einen 17-Jährigen tödlich verlaufene Eisbärenangriff von Freitag (5.8.) fand in den frühen Morgenstunden statt, als die Gruppe noch in den Zelten war und schlief. Der sehr aggressive Bär kam für die Gruppe somit völlig überraschend und wütete in einem (mehreren?) Zelt. Vier weitere Personen wurden verletzt, zwei davon schwer im Gesichtsbereich.
Bei dem Bären handelte es sich um ein Männchen, das mit einem Gewicht von 250 kg nicht allzu groß war.
Neben Schock und Trauer um den Toten stellt sich nun die Frage, wie es zu dem tödlichen Verlauf kommen konnte. Zunächst ist abzuwarten, bis Details des Geschehens bekannt werden, um die Situation zu beurteilen und Schlüsse für die Bewertung von Risiken und Sicherheitsmaßnahmen ziehen zu können.
Grundsätzlich ist bei Zeltlagern wichtig:
- Um das Lager ist in ausreichendem Abstand ein Alarmzaun aufzustellen. Die richtige Aufstellung ist wichtig, um das korrekte Funktionieren zu gewährleisten. Dennoch darf man sich nicht in falscher Sicherheit wiegen: diese technischen Anlagen haben schon oft genug versagt oder wurden von Bären ausgetrickst.
- Besser ist es, einen Polarhund (Schlittenhund) dabeizuhaben, der im Falle der Annäherung eines Bären Alarm schlägt
- oder aufmerksame Nachtwache zu halten, sofern die Gruppengröße dies zulässt
- und das Lager nicht an zu exponierten Stellen zu errichten, wie kleine Inseln oder direkt am Ufer.
- Lebensmittel, insbesondere Frischwaren und Fleisch, nicht im Zelt lagern.
- Selbst bei gründlicher Anwendung aller Vorsichtsmaßnahmen bleibt wie in vielen Lebensbereichen das sogenannte „Restrisiko“. Zelten in Eisbärenland wird niemals vollständig gefahrlos sein, genauso wenig beispielsweise wie die Teilnahme am Straßenverkehr.
P.S. letzte offizielle Meldungen bestätigen, dass die Knallkörper des Alarmzauns nicht explodiert sind, als der Eisbär ins Lager kam. Warum, ist bislang noch unbekannt.
Lager im Eisbärenland. Das Risiko eines potenziell gefährlichen Eisbärenbesuchs lässt sich minimieren, aber niemals völlig ausschalten.
Tödlicher Eisbärenangriff im Tempelfjord
Am frühen Morgen des 05. August hat es im Tempelfjord einen Eisbärenangriff gegeben. Zum ersten Mal seit 1996 ist dabei ein Mensch ums Leben gekommen, weitere vier wurden verletzt. Die betroffenen Personen gehörten einer englischen Jugendgruppe an und waren zwischen 16 und 29 Jahren alt. Bei dem Toten handelt es sich um einen 17-jährigen Jugendlichen. Die Verletzten sind in Tromsø in ärztlicher Behandlung. Der Eisbär wurde erschossen.
Weitere Details sind bislang nicht bekannt.
Ein schönes, aber auch gefährliches Tier.
Quelle: Sysselmannen
Sommerpause der Spitzbergen-Nachrichten
Seit Mai keine Nachrichten auf Spitzbergen.de – woran liegt es? An der laufenden Sommersaison, die der Seitenbetreiber auf Spitzbergen in abgelegenen Gegenden verbringt, so dass er nur selten dazu kommt, diese Seite zu aktualisieren. Stattdessen gibt es alle paar Wochen einen Reisebericht und Bilder unter »Bilder und Reiseberichte/Arktis-Saison 2011«.
Die wichtigsten Neuigkeiten, v.a. Änderung von Bestimmungen (bislang nicht angefallen, Stand Anfang August), werden bis Herbst nachträglich an dieser Stelle zu lesen sein.
Die internetfreie Sommerheimat des Seiteninhabers.
Quelle: Hausmitteilung
Buchungssystem in der Kritik
Das Online-Buchungssystem unter www.svalbard.net des Reiseunternehmerverbandes in Longyearbyen hatte sich insbesondere für kleine Anbieter, die ansonsten auf dem Markt weniger sichtbar sind, zu einem wichtigen Vertriebsweg entwickelt. Die Umstellung auf eine neue Software erwies sich als Flop, da das neue System nicht hielt, was der Lieferant versprochen hatte. Kleine Reiseveranstalter in Longyearbyen klagen über Umsatzeinbuchen von 60-70%, in Einzelfällen von bis zu 95%. Einige Firmen, die oft von einer Einzelperson betrieben werden, konnten nur durch Zusatzarbeit in anderen Bereichen überleben.
Der Verband, dem der Direktor des größten lokalen Tourismus-Unternehmens vorsitzt, weist Kritik von sich und macht primär den Software-Lieferanten verantwortlich. Auch hätten die kleineren Unternehmer nicht alle ihre Hausaufgaben gemacht.
Auf dem Markt besser sichtbar: Große Anbieter, die Hotels in Longyearbyen betreiben.
Quelle: Svalbardposten 6/2011
Longyearbyen-Kohle stark nachgefragt
In der Grube 7 im Adventdalen bei Longyearbyen werden derzeit Jahr für Jahr etwa 75 000 Tonnen Kohle abgebaut. 50 000 davon werden exportiert, größtenteils nach Deutschland. Die Eigenschaften dieser Kohle machen sie zu zu einem begehrten Rohstoff in der metallurgischen Industrie, so dass deutsche Unternehmen im Mai sogar einen außerplanmäßigen Frachter und Ladearbeiten trotz des in einem Wintersturm beschädigten Kohlekrans finanzierten.
Laut Grubenchef Håvard Dyrkolbotn gibt es »ohne Kohle aus Grube 7 keinen Mercedes auf dem Markt«.
Bergbauausrüstung bei Grube 7.
Quelle: Svalbardposten 6/2011
Eisbären-Kinderstuben auf Kong Karls Land
Während eines fast 4-wöchigen Aufenthaltes auf der Insel Kongsøya, die zum Kong Karls Land ganz im Osten Spitzbergens gehört, zählten Feldforscher mindestens 13 Schneehöhlen, in denen Eisbärinnen in den Monaten zuvor ihren Nachwuchs zur Welt gebracht hatten. 2009 waren 25 Geburtshöhlen gefunden worden. Die geringere Zahl war erwartet worden und hängt vermutlich damit zusammen, dass das Meer um das Kong Karls Land gegen Ende 2010 weitgehend eisfrei war, so dass die Inseln für die trächtigen Weibchen nur schwer zugänglich waren. Ob es dafür andernorts mehr Geburtshöhlen gab, ist unbekannt.
Das Kong Karls Land zählt zu den wichtigsten Eisbären-Wochenstuben der gesamten Arktis und darf nur mit spezieller Genehmigung betreten werden.
Kong Karls Land in dichtem Treibeis.
Quelle: Norwegisches Polarinstitut
Sysselmannen empfiehlt Genehmigung einer neuen Kohlegrube
Die schon seit längerem geplante, neue Kohlegrube am Lunckefjellet, zwischen Reindalen und Sveagruva, hat eine entscheidende Hürde auf dem Weg zur Realisierung genommen: Nach öffentlicher Hörung und Prüfung hat der Sysselmannen dem norwegischen Umweltministerium die Genehmigung des Projektes unter Auflagen empfohlen.
Mit der neuen Grube hofft die Bergbaugesellschaft (SNSK), den Betrieb in Sveagruva ab 2013 für eine Reihe von Jahren weiterführen zu können. Die derzeit in Abbau befindlichen Flöze neigen sich dem Ende zu, die Qualität wird schlechter. Zum neuen Projekt gehört ein Weg zwischen der Siedlung Sveagruva und dem Lunckefjellet, der teilweise über den Gletscher Marthabreen führen würde.
Folgende Auflagen empfiehlt der Sysselmannen als Bedingung:
- Anschließende vollständige Rückführung und Wiederherstellung des Wildnischarakters.
- Begrenzung des Staubaustritts.
- Verschiffung ohne Gebrauch von Schweröl.
- Ausschließen von Störungen von Tieren oder Verunreinigung im Nordenskiöld Land Nationalpark.
- Auflagen zum Gebrauch von Chemikalien.
- Überwachung, Kontrolle und Berichterstattung.
Das Reindalen, aufgenommen von oberhalb der geplanten Grube.
Quelle: Sysselmannen
Kostenübernahme für Rettungsaktionen
Mittlerweile führt der Sysselmannen zusammen mit dem Roten Kreuz jährlich 60-80 Such- und Bergungsaktionen durch, die meisten davon mit dem Hubschrauber. Möglicherweise hat die Verfügbarkeit moderner Kommunikationsmittel (Satellitentelefon, Notpeilsender) zu einer Herabsetzung der Hemmschwelle bei der Planung von Touren geführt.
Für Zugereiste sind die Touren in den meisten Regionen Svalbards schon lange melde- und versicherungspflichtig (für Einwohner Spitzbergens gilt dies bei Reisen in die Schutzgebiete). In der Praxis hat bei Suchaktionen bislang meistens die Verwaltung die Kosten übernommen, auch wenn eine Versicherung vorgeschrieben und vorhanden war. Da die Kosten mit der Zahl der SAR (Search-and-rescue) Operationen ansteigen, sollen diese künftig regelmäßig nicht mehr vom norwegischen Steuerzahler, sondern vom Verursacher getragen werden. Damit war prinzipiell schon bislang zu rechnen, die praktische Durchführung wird künftig verschärft. Bei Hubschraubereinsatz ist schnell mit Kosten von 100000 NOK (derzeit ca. 12700 Euro) und mehr zu rechnen.
Dies gilt für melde- und versicherungspflichtige Touren. Für andere Touren, also für Zugereiste innerhalb des Verwaltungsgebietes 10 (Nordenskiöld Land, Dickson Land, Brøggerhalvøya), werden die Kosten den Geretteten weiterhin nur bei „grober Unachtsamkeit“ auferlegt.
SAR-Hubschrauber: Ein teures Vergnügen.
Quelle: Sysselmannen
News-Auflistung generiert am 10. Mai 2025 um 00:12:31 Uhr (GMT+1)