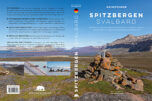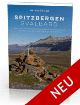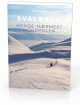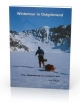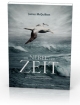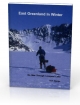-
aktuelle
Empfehlungen- Spitzbergen unter Segeln 2025
Kurs Arktis im Sommer 2025
- Spitzbergen-Reiseführer
Aktualisierte Neuauflage 2025
- Spitzbergen unter Segeln 2025
Kurs Arktis im Sommer 2025
Seitenstruktur
-
Nachrichten
- Monat auswählen
- Juni 2025
- Mai 2025
- April 2025
- März 2025
- Februar 2025
- Januar 2025
- Dezember 2024
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- April 2024
- März 2024
- Februar 2024
- Januar 2024
- Dezember 2023
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- August 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- Februar 2022
- Januar 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- Oktober 2021
- September 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- April 2021
- März 2021
- Februar 2021
- Januar 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- September 2020
- August 2020
- Juli 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- April 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Januar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- Oktober 2019
- September 2019
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- Januar 2019
- Dezember 2018
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- August 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Januar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Juli 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012
- März 2012
- Februar 2012
- Januar 2012
- Dezember 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- August 2011
- Mai 2011
- April 2011
- März 2011
- Februar 2011
- Januar 2011
- Dezember 2010
- November 2010
- September 2010
- August 2010
- Juli 2010
- Juni 2010
- Mai 2010
- April 2010
- März 2010
- Februar 2010
- November 2009
- Oktober 2009
- September 2009
- August 2009
- Juli 2009
- Juni 2009
- Mai 2009
- April 2009
- März 2009
- Februar 2009
- Januar 2009
- Dezember 2008
- November 2008
- Oktober 2008
- August 2008
- Juli 2008
- Juni 2008
- Mai 2008
- April 2008
- März 2008
- Februar 2008
- April 2000
- Monat auswählen
-
Wetterinformationen
-
Newsletter

| Spitzbergen-Reiseführer: Neuauflage ist da 🤩 |
Home
→
Jahres-Archiv: 2012 − News & Stories
Segelschiff vor Spitzbergens Nordküste gesunken
Vor der Nordküste Spitzbergen ist vergangene Woche ein kleines Segelboot nachdem es auf Grund gelaufen war, gesunken. Die beiden englischen 70jährigen Segler konnten ca. 2 Stunden nachdem sie in ihr Rettungsboot gestiegen waren per Hubschrauber gerettet werden. Die Männer waren mit ihrem Segelschiff auf eine unter der Wasseroberfläche liegende Klippe aufgelaufen. Zunächst versuchten die Segler, sich auf einer Rettungsinsel in Sicherheit zu bringen, aber die Rettungsinsel war defekt. Sie konnten dann gerade rechtzeitig ein noch zusammengepacktes Schlauchboot aufblasen, bevor, unmittelbar nachdem sie im Schlauchboot saßen, ihr Segelschiff sank. Trotz schlechter Sicht und Schneegestöber konnte der Hubschrauber sie mit leichten Unterkühlungen ins Krankenhaus nach Longyearbyen fliegen.
Die Untiefe an der Mündung zum Raudfjord ist auf den Seekarten deutlich eingezeichnet.
Nordküste Spitzbergens von der Insel Moffen aus gesehen
Erdbeben bei Spitzbergen
Am Sonntag (02. September) hat es im Nordatlantik, westlich von Spitzbergen, ein Erdbeben der Stärke 5,2 gegeben. Damit war das untermeerische Beben allerdings zu schwach, um ernsthaft spürbar zu sein, allenfalls in Ny Ålesund, dem nächstgelegenen Ort, hätten aufmerksame Beobachter die leichten Erschütterungen wahrnehmen können.
Zwei Tage zuvor hatte es in der Nähe von Jan Mayen ein untermeerisches Erdbeben gegeben, das bei der Station zu großen Erlebnissen und kleinen Sachschäden führte. Der mittelatlantische Rücken, der zwischen Spitzbergen und Grönland verläuft, ist eine Zone häufiger Erdbeben, die aber nur sehr selten nennenswerte Stärke erreichen. Spitzbergen selbst ist keine Erdbebenzone, nur im Storfjord verläuft ein kleines Erdbebengebiet, und auch nur sehr selten von spürbaren Erdbeben betroffen.
Diese Verwerfungen im Billefjord gingen in der geologischen Vergangenheit mit kräftigen Erdbeben einher, sind aber heute von Natur aus »stillgelegt«.
Quelle: Lofoten-Tidende
Erfahrungsbericht Eisbärenalarm
Eisbärenalarmsysteme für Zeltlager sind ein Ärgernis: Für sicheres Zelten sind sie erforderlich, sofern kein zuverlässiger Polarhund oder genügend Personen für eine nächtliche Eisbärenwache vorhanden sind. In Longyearbyen ist aber derzeit kein System zuverlässig auf dem Markt erhältlich. Im Oktober 2011 wurde auf dieser Seite davon berichtet, dass die britische Firma Arctic Limited ein eigens hergestelltes System vertreibt. Nun liegen erste Erfahrungsberichte von Nutzern vor:
»Wir haben uns nach vielen Tests und Überlegungen für dieses System von Arctic Ltd. entschieden und vier Einheiten gekauft. Unsere Erfahrung ist durchwachsen. Die Teile sind nicht billig, aber hervorragend verarbeitet und recht klein und leicht, also auch auf Skitouren gut zu transportieren. Wir haben nicht den mitgelieferten, sehr dünnen Faden verwendet, sondern eine Rolle stärkere Schnur (die auch besser zu sehen war). Wir haben Knallpatronen mitgebracht, die sich allerdings bei Wind als nicht besonders laut erwiesen haben. Evtl. gibt es da vor Ort andere Patronen mit einem lauteren Knall. Das System hat einmal nachts bei Wind ausgelöst, weil ein Pulkagestänge umgekippt und auf den Zaun gefallen ist. Einmal habe ich es morgens aus Versehen (einfach den Zaun übersehen) ausgelöst. Ansonsten sind uns beim Aufbau (genauer beim Scharfmachen) einige Patronen losgegangen, weil die Schnur zu sehr gespannt war. Aufgespannt haben wir den Zaun mithilfe der Skier, an welche das System mit Spannriemen befestigt wurde. Das hat sich gut bewährt. Nur ein Teil war so konstruiert, dass man es am Ski nur schlecht spannen, bzw. scharfmachen konnte.
Wir haben keine Vergleichsmöglichkeiten zu den auf Spitzbergen üblichen Modellen. Wir hätten uns gewünscht, dass das System von Arctic Ltd. etwas lauter gewesen wäre. Zudem muss man es aufgrund der geringen Größe beim Scharfmachen doch ziemlich vorsichtig behandeln, um nicht aus Versehen einen Schuss auszulösen.«
Auch der Autor hat das System im Juli 2012 getestet. Das Fazit vorneweg: Das System von Arctic Ltd. ist empfehlenswert, nicht nur, weil es derzeit das am leichtesten erhältliche ist. Im Gegensatz zu den sonst »üblichen« (aber derzeit kaum zugänglichen) Modellen sind die Knallkörper (Schrotpatronen ohne Schrot) deutlich preisgünstiger, der Anschaffungspreis geht in die Auslösermechanismen, die vielfach wiederverwendbar sind und nicht in Einwegkomponenten. Diese (also die Knallkörper) sind so leicht und billig, dass man problemlos eine relativ hohe Anzahl davon mitführen kann, was sehr praktisch ist, da gelegentliche Fehlauslösungen auf Dauer kaum vermeidbar sind (Wind, unaufmerksame Lagerbewohner, Rentiere, …).
Einigkeit besteht, dass der Knall lauter sein sollte. Laut Hersteller gibt es Spezialmunition, die diesem Wunsch entspricht. Auch die ideale Schnur ist noch zu finden: Nach Ansicht des Autors sollte diese so dünn wie möglich sein, um für Eisbären möglichst unsichtbar zu sein und um die Gefahr unbeabsichtigter Auslösungen durch Wind zu reduzieren. Gleichzeitig muss sie natürlich reiß- und abriebfest sein und sie sollte nicht dehnbar sein (dann wird sie vorm Auslösen möglicherweise fühlbar).
Im Fall der Bestellung des Autors nahm der Versand einige Zeit in Anspruch, was aber nicht am Hersteller, sondern an der Post lag. Laut Hersteller ist der Versand etwa nach Deutschland rechtlich problemlos, Gegenstimmen hat es hier allerdings auch schon gegeben, denen zufolge bestimmte amtliche Prüfungen erst noch erfolgen müssten, immerhin handelt es sich um Mechanismen, die zum Abschuss von Schrotmunition (ohne Lauf) geeignet sind. Dies ist derzeit nicht abschließend geklärt.
Entscheidend für die möglichst zuverlässige Funktion sind auch solide, gut im Boden verankerte Pfosten. Hier haben sich robuste Aluminiumrohre bewährt. Um sich auf verschiedene Untergründe einstellen zu können, kann eine Befestigung der Auslöser sinnvoll sein, die in der Höhe verstellbar ist, etwa mit Schlauchschellen. Zwei Drähte übereinander erhöhen die Sicherheit noch einmal deutlich.
Wie wichtig das Thema Eisbärensicherheit beim Zelten ist, hat deutlich sichtbar zuletzt der tödliche Eisbärenangriff auf ein englisches Zeltlager im August 2011 gezeigt (auf dieser Seite wurde mehrfach berichtet).
Eisbärenalarmsystem von Arctic Ltd., mit Kabelbinder und starkem Klebeband an einem Alurohr befestigt.
Minimalrekord bei Treibeis
Seit 30 Jahren überwacht das norwegische meteorologische Institut ständig die Treibeisausbreitung, ähnliche Einrichtungen in anderen Arktis-Anrainerstaaten tun dasselbe mit vergleichbaren Ergebnissen: Nie war die Treibeisfläche in der Arktis so gering wie jetzt, nicht einmal im Spätsommer 2007, als die kräftig geschrumpfte Fläche bereits für breite Medienaufmerksamkeit sorgte. Im Vergleich zu 1979 fehlen jetzt 3 Millionen Quadratkilometer Eis, was der achtfachen Fläche Norwegens (ohne Spitzbergen) entspricht.
Sorgen bereitet nicht nur der Flächenverlust, sondern auch die qualitative Änderung: Der früher hohe Anteil an solidem, mehrjährigem Eis ist stark geschrumpft. Stattdessen besteht die Packeisfläche um den Nordpol überwiegend nur noch aus relativ dünnem einjährigen Eis, das weder in Sachen Dauerhaftigkeit noch als Lebensraum mit den dickeren mehrjährigen Schollen mithalten kann.
Die Treibeisgrenze bei Spitzbergen liegt derzeit fernab aller Küsten weit nördlich der Inselgruppe. Bedeutend dramatischer ist der Eisschwund aber auf der anderen Seite der Arktis, nördlich von Westkanada, Alaska und Sibirien.
Eis in der Hinlopenstraße, Mitte Juli 2005: so etwas hat es diesen Sommer nicht gegeben.
Russischer Atomabfall in den Nordmeeren
Auf dem Grund der Barentssee und der Karasee (östlich von Novaya Zemlya) liegen umfangreiche Altlasten von Atommüll, Atomreaktoren aus Schiffen und U-Booten sowie versenkte und gesunkene Schiffe und U-Boote mit Atomantrieb oder anderen radioaktiven Stoffen. Soweit nichts Neues. Die nun von russischer Seite den norwegischen Behörden zugänglich gemachte Inventarliste offenbart allerdings erschreckende Mengen, die bislang deutlich unterschätzt wurden. So „lagern“ auf dem Boden der arktischen Meere nicht etwa 11000 (ja, elftausend!) Container mit Atommüll, sondern mindestens 17000, dazu 19 versenkte Schiffe mit radioaktivem Abfall, 5 „Reaktorsektionen“, 3 Atom-U-Boote mit radioaktivem Brennstoff, Brennstoff des Eisbrechers „Lenin“ sowie „735 weitere radioaktive Einheiten“, was auch immer man sich darunter vorzustellen hat. Ob die Liste tatsächlich vollständig ist, ist unbekannt.
Neu ist die Offenheit, mit der Russlands Behörden den Umfang der strahlenden Erbschaft ihrem Nachbarn Norwegen mitteilen. Derzeit ist eine russisch-norwegische Forschergruppe damit beschäftigt, dem genauen Verbleib und Zustand der gefährlichen Altlast nachzuspüren.
Frühere Untersuchungen haben ergeben, dass das Niveau der Radioaktivität im Bereich der Barentssee sehr gering ist, erstaunlich gering angesichts der geschilderten Mengen von Atommüll. Dies mag sich künftig aber ändern, wenn Behälter und Reaktionen durchrosten. Im Einzelfall soll sogar die Gefahr von Kettenreaktionen bis hin zu Atomexplosionen drohen können, was die Behörden bislang jedoch nicht bestätigt haben.
Bis 1985 war es international üblich, Atommüll im Meer zu verklappen. Die Sowjetunion tat dies bis 1992. In jüngerer Vergangenheit wurden, auch mit substantieller Hilfen der EU und Deutschlands, bereits erhebliche Mengen radioaktiver Stoffe aus Küstengebieten und Häfen rückgeholt.
Der langfristige Verbleib radioaktiver Stoffe, die teilweise über äußerst lange Zeiträume gefährlich bleiben, ist ein Problem, das für Menschen vom Einzelnen bis hin zu Gesellschaften und Volkswirtschaften massive Auswirkungen hat und bislang nicht geklärt ist.
Der russische Atomeisbrecher Yamal in Franz Josef Land (2004). Foto: Christine Reinke-Kunze.
Quelle: Aftenposten, 28. August 2012
Unglück am Esmarkbreen
Am Dienstag, 21.8.2012, kam es zu einem dramatischen Unglück am Esmarkbreen (Esmark Gletscher). Touristen fuhren zusammen mit ihren Guides in Zodiacs (Schlauchbooten) vor der Gletscherfront, als sich ein größerer Eisbrocken aus der ca. 25m hohen Abbruchkante löste. Dabei kam eine Touristin ums Leben. Sie wurde vermutlich von einem der Eisbrocken getroffen. Die genauen Unfall- und Todesumstände werden untersucht. Zunächst wurden Fotos und Filmmaterial bei Touristen und Crewmitgliedern sichergestellt.
Der Esmarkbreen liegt im Inneren der Ymerbukta auf der Nordseite des Isfjord.
Ymerbukta mit Esmarkbreen
Quelle: Svalbardposten 33/2012
Kommerzielle russische Hubschrauberflüge und der Spitzbergenvertrag
Immer wieder taucht das Thema Hubschrauberverkehr in Spitzbergen als Zankapfel zwischen Russen und norwegischen Behörden auf. In den russischen Siedlungen Barentsburg und Pyramiden, wo das Hotel bald wieder geöffnet werden soll, will man künftig verstärkt auf Tourismus setzen und als Transportmöglichkeit kommerzielle Hubschrauberflüge anbieten (»Flightseeing« ist in Spitzbergen generell verboten).
Die Russen berufen sich dabei auf das Nicht-Diskriminierungsprinzip des Spitzbergenvertrages von 1920 (in Kraft seit 1925), der allen Unterzeichnerländern und ihren Firmen und Bürgern die gleichen Rechte einräumt. Die norwegischen Behörden berufen sich auf das norwegische Luftfahrtgesetz, dass es nur norwegischen Fluggesellschaften erlaubt, in Norwegen kommerziell zu arbeiten. Letztlich geht es um die Frage, ob das norwegische Landesrecht, demzufolge »Svalbard Teil des Königreiches Norwegen« ist, höher zu bewerten ist als der nach wie vor gültige internationale Vertrag von 1920/25, demzufolge die »Inselgruppe Spitzbergen voller und absoluter norwegischer Souveränität unterstellt« ist, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Von einer Eingliederung des Territoriums »Svalbard« in Norwegen spricht erst ein Landesgesetz von 1925 (nach Inkrafttreten des Vertrages).
Regelmäßig Zankapfel:
Russischer Hubschrauber.
Walrosse im Wachstumstrend
Das Norwegische Polarinstitut hat bei 5 Walrosskolonien (Lågøya, Storøya, Kapp Lee, Andréetangen, Havmerra/Tusenøyane) automatische Kameras aufgestellt, um Bestand und Verhalten von Walrossen zu dokumentieren. Vorläufige Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Bestand in jüngerer Zeit zunimmt. Eine Zählung von 2006 ergab einen Bestand von etwa 3000 Walrossen in den Gewässern rund um die Inselgruppe, seitdem scheinen es mehr geworden zu sein.
Die Auswertung der Bilder aus den automatischen Kameras deutet auch darauf hin, dass die Tiere sich weder von Eisbären noch Touristen nennenswert stören lassen. Trotz zahlreicher Besuche ist es nicht zu Störungen durch Touristen gekommen. Über die Jahre schwanken die Zahlen bei einzelnen Ruheplätzen allerdings stark, vermutlich als Folge natürlicher Vorgänge wie etwa Schwankungen der lokalen Nahrungsgrundlage.
Einsame Walross-Junggesellen auf der Edgeøya
Campingplatz jetzt in niederländischer Hand
Nach mehreren Eignerwechseln über die Jahre ist der Campingplatz bei Longyearbyen ab jetzt fest in niederländischer Hand. Michelle van Dijk, die zuvor zeitweise zusammen mit Andreas Umbreit Eignerin und Betreiberin war, ist jetzt vollständig Eignerin und hat schon damit angefangen, den (fast) nördlichsten Campingplatz der Welt freundlicher zu gestalten.
Der Campingplatz bei Longyearbyen
Anja Fleig (1974-2012)
Viele kommen und gehen auf den Schiffen, die regelmäßig die Küsten der Polargebiete befahren. Manche bleiben für eine Weile, aber nur sehr wenige finden an den Polen eine echte zweite Heimat und in den Expeditionsschiffen den Weg dahin. Anja Fleig gehörte ohne jeden Zweifel zur letzteren Gruppe, sie war unter den angesehensten Expeditionsleitern des Metiers.
Am 14. Juli 2012 verstarb Anja viel zu früh nach längerer Krankheit.
Wie viele andere Freunde und Kollegen vermisst der Autor dieser Zeilen, der Anja seit 1999 kannte, Anja als der gute Mensch, der sie war, die gute Freundin, die exzellente Fahrtleiterin. Wenige können sich in Bezug auf das Wissen und die Erfahrung innerhalb ihres Metiers sowie hinsichtlich der Ansprüche, die sie an sich stellte, mit ihr vergleichen. Indem sie ihr spannendes, abenteuerliches, aber auch glückliches Leben so lange gelebt hat, hatte sie viele Gelegenheiten, immer wieder unglaublich Schönes zu erleben, das andere, wenn überhaupt, nur einmal erblicken dürfen. In der Vorstellung, dass sie von der Schönheit dieser Welt mehr gesehen hat als andere, die viel älter werden, liegt ein Trost, wenn auch ein schwacher.
2009 heiratete Anja ihren Freund Tim in Spitzbergen auf der Polar Star, die ihnen da schon zur gemeinsamen zweiten Heimat geworden war. 2010 kam ihr gemeinsames Kind zur Welt.
Anja in glücklichen Tagen 2007 auf der Bäreninsel
Das Stiefelmysterium
Das Sommerloch füllt in Spitzbergen kein Orakel-Eisbär und kein schielendes Rentier, sondern das Stiefelmysterium aus der Bergbausiedlung Sveagruva: Aus einer Bergarbeitergarderobe sind 40 Stiefel verschwunden. Das Spannende dabei: Futsch sind nur die rechten Schuhe, die linken Gegenstücke stehen allesamt noch da. Es handelt sich um solide, sehr offensichtlich gebrauchte Bergarbeiterschuhe der Größen 38 bis 47. Nun wird gerätselt, wer die Diebe waren: Außerirdische? Trolle? Rechtsextreme, die nichts anfassen, was irgendwie links ist? …?
Vor Ort nimmt man die Angelegenheit mit Humor, wüsste aber dennoch gerne, was dahinter steckt. Und wenn das verschwundene Schuhwerk wieder auftauchte, wär’s sicher auch den betroffenen 40 Kumpels recht.
40 einsame linke Stiefel in Sveagruva. Foto © Jan Ove Steinsmo, Store Norske.
Quelle: Dorfklatsch, Aftenposten
Grundberührung der MS Expedition
Am 23. Juli lief die MS Expedition, ein kleines Kreuzfahrtschiff (100 Passagiere, 57 Besatzung) bei Isispynten an der Ostküste von Nordaustland auf Grund. Entgegen erster Annahmen wurde der Rumpf leicht beschädigt und eine geringe Menge Wasser trat ins Schiff ein. Laut Reederei und Behörden habe jedoch zu keiner Zeit Gefahr für Menschen oder Umwelt bestanden, es seien keine Stoffe wie Öl, Diesel etc. ausgetreten. Das Schiff konnte aus eigener Kraft freikommen und nach Longyearbyen zurückfahren.
Dies war bereits der dritte Grundkontakt von Passagierschiffen in Spitzbergen in diesem Sommer. Am 23. Juni hatte die „National Geographic Explorer“ Grundberührung in der Engelskbukta und am 10. Juli lief das Tagestourenboot „Polar Girl“ vor Grumantbyen auf Grund.
Alle Grundberührungen geschahen, während die Schiffe ufernah navigierten, um den Passagieren Sightseeing zu ermöglichen. Allen ist auch gemeinsam, dass sie bei langsamer Geschwindigkeit geschahen und letztlich weitgehend undramatisch verliefen. Dennoch sind die Vorfälle jeder für sich und insbesondere in dieser Häufung und in einem Gebiet, in dem Rettungs- und Ölbereitschaftskapazitäten sehr begrenzt sind, weitgehend inakzeptabel. Es gibt Ausnahmen: Kleine, kräftige Schiffe können „vorsichtige“ Grundberührungen durchaus tolerieren, in manchen (in Spitzbergen seltenen) Fällen wird sogar absichtlich der Bug oder Kiel in den Kies gesetzt, für Kapitäne mit Erfahrung von niederländischen Flachbodenseglern ist das Alltag. Das hat aber mit Schiffen wie der Expedition nichts zu tun.
Ein Problem ist, dass das norwegische „Kartverk“ mit der Vermessung der Gewässer nicht nachkommt. Bei derzeitiger Arbeitsweise werden noch etliche Jahrzehnte vergehen, bis das gesamte Fahrwasser rund um die Inselgruppe kartiert ist. Norwegische Behörden halten die Sicherheit des Schiffsverkehrs um Spitzbergen keine trotz der offiziellen politischen Priorisierung der Gebiete im hohen Norden („Nordområde-satsing“) anscheinend nicht für wichtig genug, um gute Seekarten zu erstellen, welche die Sicherheit des Schiffsverkehr entscheidend verbessern würden.
Die MS Expedition in Ny Ålesund, Juli 2011. Das Schiff gehörte früher unter dem Namen Midnattsol zur Hurtigruten-Flotte.
Quelle: Svalbardposten 29/2012
Älter als bisher angenommen
Eisbären sind vermutlich älter, als bisher angenommen. Neue Studien zeigen, dass Eisbären nicht erst seit ca. 150000 Jahren sondern seit 600000 die Erde besiedeln. Vor ca. 4 bis 5 Millionen Jahren begannen sich Eis- und Braunbär aufgrund von Klimawandel und Veränderungen im genetischen Material zu jeweils eigenständigen Arten zu entwickeln. Zu diesem Resultat kamen die Eisbärenforscher mit Hilfe genetischer Untersuchungen, die sie an Eis-, Braun- und Schwarzbären vornahmen. Außerdem trug ein ca. 150000 Jahre alter Eisbärenkiefer, der 2004 auf Spitzbergen gefunden wurde zur Vervollständigung der Daten bei.
Eisbären
Quelle: Svalbardposten Nr. 2912
Einführung der Lotsenpflicht auf Spitzbergen: erster Lotsenauftrag
Seit dem 01. Juli wird die Lotsenpflicht schrittweise in Spitzbergen eingeführt. Zunächst gilt die Lotsenpflicht verbindlich für die Anfahrt auf Sveagruva, anderswo ist das Anfordern eines Lotsen zunächst freiwillig. Am 02. Juli machte als erstes Schiff der deutsche Kreuzfahrer Aida Cara (Passagierkapazität 1186) davon Gebrauch. Der Kapitän war zuvor nie in Spitzbergen gewesen und hatte daher beschlossen, den Lotsen zu bestellen. Dieser kam für den Auftrag mit dem Flugzeug aus Norwegen angereist, eine Logistik, die künftig wohl beibehalten wird.
Die Aida Cara legte am 02. Juli mit Lotsenhilfe erfolgreich im Hafen von Longyearbyen an.
Quelle: Svalbardposten (2612)
Managementplan Ost-Svalbard
Mitte Juli hat der Sysselmannen seinen Vorschlag für einen neuen Managementplan für die großen Naturreservate im Osten Svalbards vorgestellt. Die radikalen, großflächigen Sperrungsvorschläge, die längere Zeit über diskutiert worden sind, scheinen vom Tisch zu sein. Die wesentlichen Änderungen bestehen laut Sysselmannen in Sperrungen von Teilen der Lågøya sowie der Tusenøyane jeweils 15. Mai bis 15. August.
Bis zum 10. Oktober können beim Sysselmannen noch Kommentare eingereicht werden, die in den endgültigen Entscheidungsprozess einfließen. Weitere Details in dieser Sache werden nach Durchsicht der veröffentlichten Unterlagen bzw. soweit sich bürokratische „Fortschritte“ ergeben an dieser Stelle nachzulesen sein.
Die Tusenøyane (im Bild die ohnehin mittlerweile völlig gesperrte Delitschøya) wird man künftig wohl in der Zeit 15.5.-15.8. nicht mehr besuchen dürfen.
Quelle: Sysselmannen
News-Auflistung generiert am 01. Juni 2025 um 18:11:06 Uhr (GMT+1)